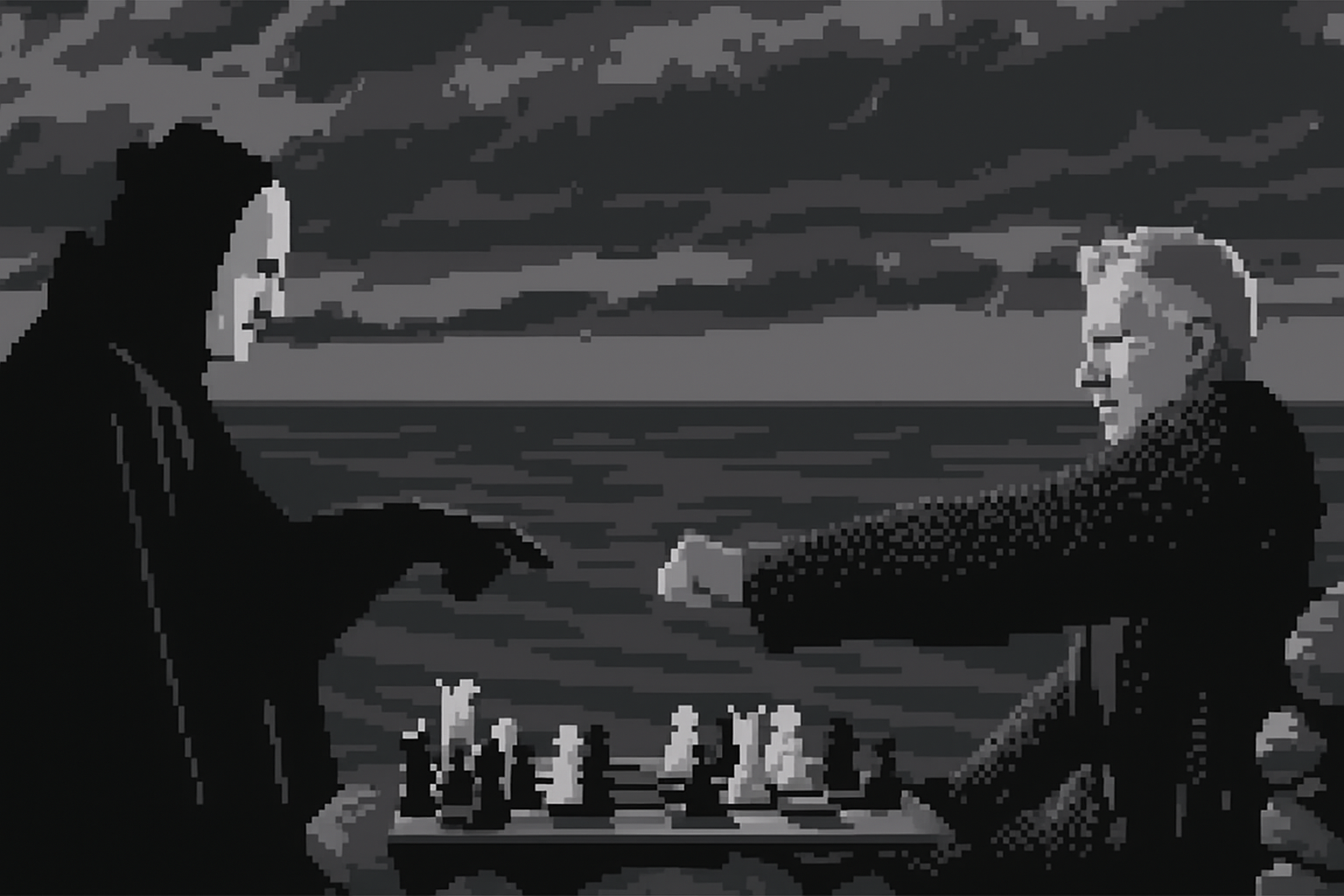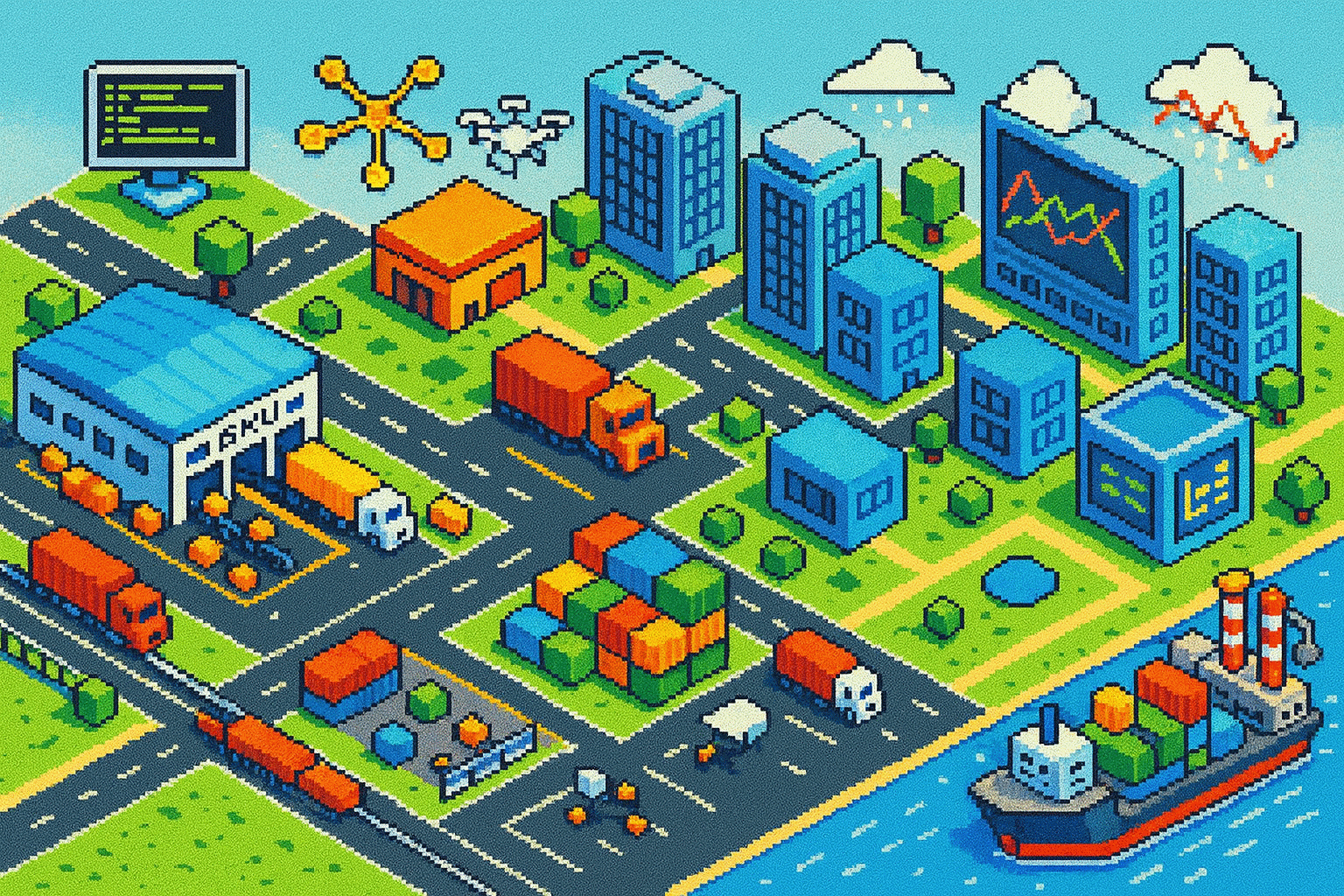Neuüberdenken der Abstimmung von Angebot und Nachfrage
Ausrichtung ist ein schönes Wort. In supply chains bedeutet es jedoch allzu oft, dass Menschen an eine Tabellenkalkulation angepasst werden, statt knappe Ressourcen an den Dingen auszurichten, die für Kunden von Wert sind. Das traditionelle Rezept läuft folgendermaßen ab: Wähle eine einzige Prognose, versammle Vertrieb, Betrieb und Finanzen, um sie zu bestätigen, und überwache anschließend die Einhaltung mit einer Vielzahl von KPIs. Das Ritual wirkt beruhigend; die Ökonomie hingegen weniger.

In Introduction to Supply Chain, plädiere ich für einen anderen Kompass. Das Ziel einer supply chain ist es nicht, Harmonie um eine Zahl herum zu bewahren; es geht darum, Kapital, Kapazität und Aufmerksamkeit dort zu bündeln, wo die erwartete, risikoadjustierte Rendite am höchsten ist. Im gesamten Buch – insbesondere in den Kapiteln Economics und The Future – versuche ich zu zeigen, wie diese Sichtweise das Wesentliche vereinfacht und das Unwichtige verwirft.
Das Problem der Ausrichtung durch Konsens
Wenn ein Unternehmen nach „einem Satz Zahlen“ fragt, geht es stillschweigend davon aus, dass Unsicherheit in eine einzige Zukunft homogenisiert werden kann. Das ist jedoch nicht möglich. Märkte sind unregelmäßig, Durchlaufzeiten schwanken, und die Randbereiche der Nachfrage sind gerade deshalb bedeutsam, weil sie am meisten schaden, wenn man sie ignoriert. Eine Konsenszahl beseitigt diese Variabilität nicht; sie verbirgt sie lediglich.
Schlimmer noch, die Ausrichtung durch Konsens behandelt die Nachfrage so, als wäre sie eine Naturgegebenheit. Preis, Sortiment und Verfügbarkeit werden als externe Faktoren des Planungsprozesses betrachtet, obwohl sie in Wirklichkeit Hebel sind, die die Nachfrage formen. Wenn die Preisgestaltung außerhalb des Aufgabenbereichs von supply chain verbleibt, dann wurde das primäre Instrument zur Abstimmung von Angebot und Nachfrage unbeachtet gelassen.
Schließlich werden die üblichen Scorecards – Servicelevels, Prognosegenauigkeit, Auslastung, Lagerumschlag – häufig als Ziele und nicht als Diagnostikinstrumente verwendet. Sie werden nicht in Geld bemessen. Ihre isolierte Optimierung zersplittert Entscheidungen, die um dieselben knappen Ressourcen konkurrieren sollten: Bargeld, Regalfläche, Produktionszeit, Aufmerksamkeit. Ein Portfolio verdient eine Portfolio-Metrik.
Für eine ausführlichere Darstellung dieser Fallstricke siehe das Kapitel The Future, das die Prognosepraktiken und die Beschränkungen der Konsensplanung in Introduction to Supply Chain untersucht.
Ausrichtung durch Ökonomie
Eine Alternative ist trügerisch einfach: Behandle die Ausrichtung als ein wirtschaftliches Problem. Preise – sowohl die Preise, die wir Kunden präsentieren, als auch die internen „Schattenpreise“, die wir unseren eigenen Engpässen zuordnen – koordinieren Entscheidungen besser als Meetings. Wenn ein Anlegeplatz, eine Kommissionierwelle oder ein Kassatag einen internen Preis hat, der seine Opportunitätskosten widerspiegelt, dann werden die Abwägungen zwischen den Bereichen vergleichbar. Der Vertrieb kann nach mehr verlangen; der Betrieb kann mit Ja oder Nein antworten; das Finanzwesen erkennt in beiden Fällen die Gewinnlogik.
Aus dieser Perspektive sind Prognosen Eingaben und keine endgültigen Urteile. Sie informieren uns über Verteilungen – was passieren könnte und wie ausgeprägt die Extreme sein können – aber sie bestimmen nicht die Entscheidung. Es geht darum, die nächste Einheit an Kapital oder Kapazität der momentan wertvollsten Möglichkeit zuzuweisen, basierend auf dem, was wir wissen und was wir angesichts der Unsicherheit zu glauben bereit sind.
Da die Nachfrage von morgen teilweise verursacht wird durch die Entscheidungen von heute, gehört die Preisgestaltung in die supply chain. Wenn sich der Preis ändert, ändert sich auch die Nachfrage; wenn sich die Nachfrage verschiebt, sollte sich auch das Angebot anpassen. Indem der Preis als erstklassiger Hebel behandelt wird, kann sich das System kontinuierlich ausrichten, anstatt sich periodisch einem Plan zu unterwerfen.
Wenn Sie die Mechanik hinter dieser Vorgehensweise verstehen möchten, erläutert das Kapitel Economics im Buch das Argument im Detail.
So sieht das in der Praxis aus
Praktisch gesehen entsteht die Ausrichtung aus einer Entscheidungsmaschine, die viele kleine, konkrete Maßnahmen bewertet – eine weitere Einheit kaufen, eine Palette umpositionieren, einen Produktionsauftrag vorziehen, einen Preis ändern. Jede Maßnahme wird bewertet, nicht erzählt: Was ist ihr erwarteter Beitrag, wenn Unsicherheit und Opportunitätskosten berücksichtigt werden? Die Maschine ordnet diese Maßnahmen und setzt kontinuierlich die besten um. Keine einzelne Zahl behauptet, die Zukunft vorhersagen zu können; stattdessen passt sich das Portfolio der Mikroentscheidungen an, sobald sich die Fakten ändern.
Abwarten wird zu einer legitimen Handlung, weil Warten einen Wert hat. Wenn ein jetziges Binden bessere Optionen für morgen ausschließt, dann muss „noch nichts tun“ gegen „jetzt etwas tun“ bestehen können. Aufschub ist keine Unentschlossenheit; er sichert die Optionserhaltung und sollte dieselbe Hürde nehmen wie jede andere Nutzung von Kapital oder Kapazität.
Messung kehrt zum Geld zurück. Servicelevel, Prognosegenauigkeit und die übrigen Kennzahlen sind nützlich als Instrumente im Dashboard, jedoch nicht als Endziele. Entscheidend ist, ob der Entscheidungsstrom die risikoadjustierte Rendite des Unternehmens über sein Portfolio an Beschränkungen erhöht. Verbessert sich ein KPI, aber nicht die Ökonomie, führt dieser KPI in die Irre.
Leser, die an den Details interessiert sind – wie man Unsicherheit darstellt, wie interne Preise sichtbar gemacht werden und wie zwischen konkurrierenden Maßnahmen abgewogen wird – finden die Einzelheiten im Kapitel Decisions in Introduction to Supply Chain.
Position zu SDA. Wenn „supply–demand alignment“ Konsens um eine Prognose bedeutet, bin ich nicht dafür. Konsens ist kein Geld. Wenn es hingegen bedeutet, knappen Ressourcen unter Unsicherheit den wertvollsten Möglichkeiten zuzuordnen, dann bin ich voll und ganz dafür – und der Mechanismus ist wirtschaftlich, nicht zeremoniell. Setzen Sie den Preis in die supply chain. Lassen Sie Prognosen informieren, aber niemals regieren. Ordnen Sie konkrete Maßnahmen nach ihrem erwarteten, risikoadjustierten Ertrag und führen Sie kontinuierlich die besten aus. Das ist eine Ausrichtung, die sich bezahlt macht.