Warum Praktiker Recht haben, diese „KI-Ära“-Vision für supply chain zu ignorieren
Wenn etwa 40 Professoren und Branchenvertreter ein “Vision Statement” für supply chain im Zeitalter der KI veröffentlichen, könnte man erwarten, dass es einem echten supply chain-Experten hilft, am Montagmorgen bessere Entscheidungen zu treffen.
Das Papier, an das ich denke, ist Supply Chain Management in the AI Era: A Vision Statement from the Operations Management Community von Maxime Cohen, Tinglong Dai, Georgia Perakis und neununddreißig Co-Autoren. Es kündigt in seinem Abstract an, dass die Operations Management (OM) Community “eine wichtige Rolle und Verantwortung” nicht nur darin hat, zu bestimmen, wie KI supply chain transformiert, sondern auch sicherzustellen, dass die supply chains, die KI ermöglichen, “nachhaltig, widerstandsfähig und gerecht” gestaltet werden. Anschließend entwickelt es ein fünfstufiges Rahmenkonzept — Intelligence, Execution, Strategy, Human, Infrastructure — und führt durch einen umfangreichen Korpus an OM- und KI-Literatur durch dieses Prisma.
Auf dem Papier klingt das vielversprechend. In der Praxis ist es jedoch eine nahezu perfekte Illustration, warum supply chain-Praktiker Recht haben, den Großteil der akademischen Produktion in unserem Bereich zu ignorieren.
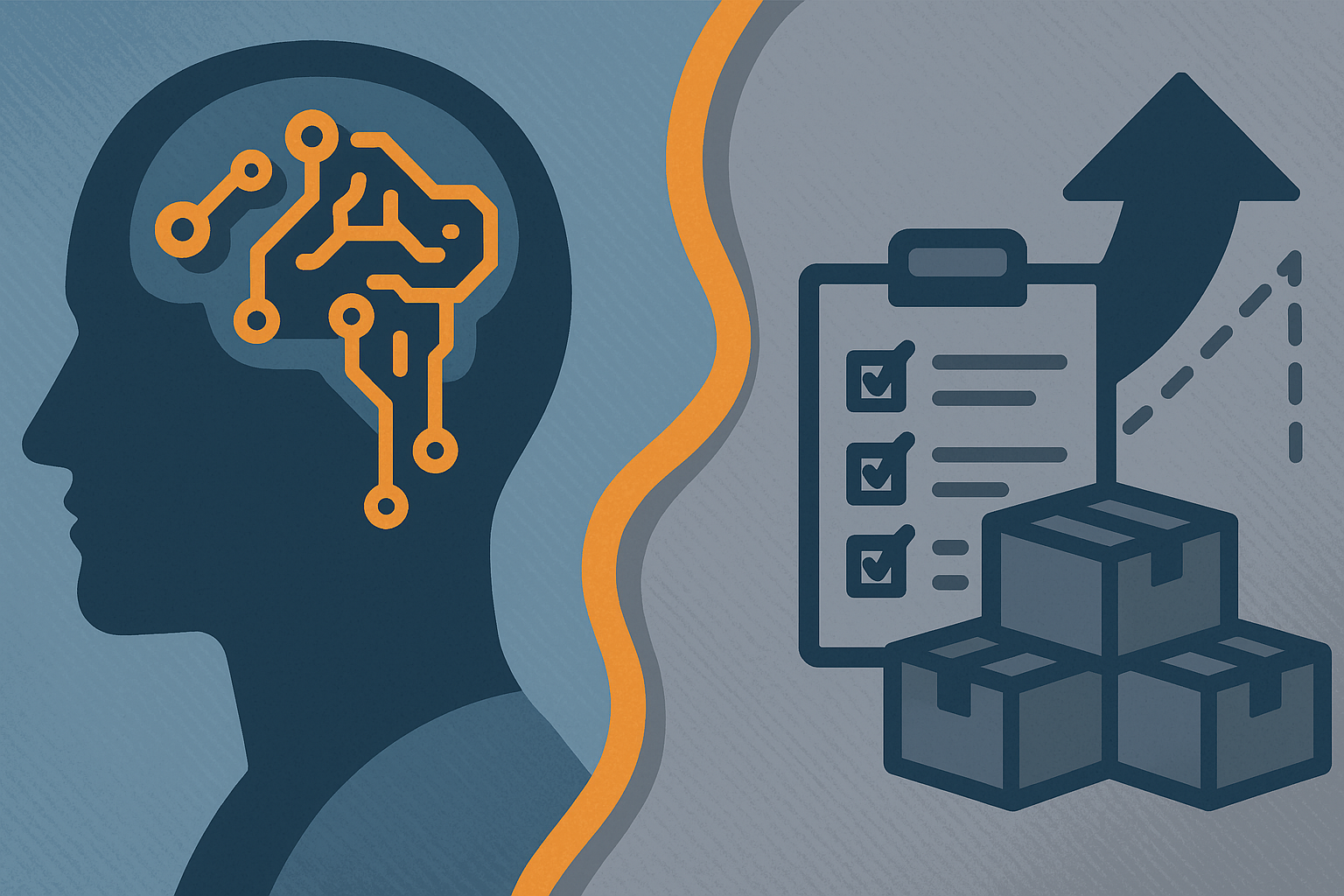
In meinem jüngsten Buch Introduction to Supply Chain, definiere ich supply chain als die Beherrschung von Optionen unter Unsicherheit im Fluss physischer Güter und argumentiere, dass in einer Marktwirtschaft das praktische Ziel von supply chain darin besteht, die risikoadjustierte Rendite des Unternehmens auf jede knappe Ressource – Kapital, Kapazität, Zeit, Goodwill – zu steigern. Alle üblichen gewünschten Ziele – höhere Servicelevels, kürzere Durchlaufzeiten, umweltfreundlicherer Transport, zufriedenere Mitarbeiter – zählen nur insofern, als sie zum langfristigen Gewinn in harter Währung beitragen. supply chain ist keine Moralphilosophie; es ist angewandte Ökonomie, die an der Bilanz überlebt oder untergeht.
Wenn man dies an dieser Messlatte misst, erfüllt dieses “Vision Statement” nahezu alle Warnsignale, denen ich in akademischen Schriften über supply chain misstraue: supra-ökonomisches Tugend-Signalisieren, Rahmen, die keine wirklichen Entscheidungen berühren, ein Schneesturm selbstreferenzieller Zitationen und der anhaltende Glaube, dass eine weitere Schicht von Zeitreihenmodellierung plus moderner KI das Planungsparadigma irgendwie erlösen wird, das Praktiker seit Jahrzehnten bereits enttäuscht hat.
Lassen Sie mich erläutern, warum.
Supra-ökonomische Tugenden und die Ethik der Bilanzen anderer Menschen
Der aufschlussreichste Satz des gesamten Papiers findet sich im Abstract:
“Die OM-Community hat eine wichtige Rolle und Verantwortung darin, nicht nur zu gestalten, wie KI supply chain transformiert, sondern auch, wie die supply chains, die KI ermöglichen, so konzipiert werden, dass sie nachhaltig, widerstandsfähig und gerecht sind.”
Die Schlussfolgerung wiederholt das gleiche Tugendtrio und erklärt, dass OM uns zu supply chains führen sollte, die “widerstandsfähiger, gerechter und nachhaltiger” sind.
Beachten Sie, was hier geschieht. Bevor sie uns sagen, wofür supply chains da sind, geben die Autoren vor, welche Adjektive sie erfüllen sollten: nachhaltig, widerstandsfähig, gerecht. Es wird niemals ein explizites ökonomisches Ziel benannt. Gewinn, Kapitalproduktivität, risikoadjustierte Rendite – diese erscheinen, wenn überhaupt, nur indirekt. Das Papier geht schlicht davon aus, dass “Effizienz” und “Resilienz” neben einer Reihe favorisierter moralischer Ziele existieren, und dass es die Aufgabe der OM-Community ist, alle gleichzeitig voranzutreiben.
In Kapitel 4.4.5 meines Buches, “Supra-ökonomische Ziele”, verwende ich diesen Begriff – supra-ökonomisch – genau für dieses Muster: Appelle an Ziele, die angeblich über das “bloße” Monetäre hinausgehen und somit das Übergehen der Disziplin von Preisen, Kosten und Opportunitätskosten rechtfertigen. Manchmal ist der Ton moralisch belehrend (“das Unternehmen sollte eine soziale Agenda verfolgen, die über den Kundenservice hinausgeht”); manchmal apokalyptisch (“eine drohende Katastrophe erfordert ein sofortiges Opfer der Rentabilität”). In beiden Fällen ist das Vorgehen dasselbe: Die ökonomische Kalkulation wird stillschweigend herabgestuft, während das bevorzugte Anliegen des Autors darüber gehoben wird.
Das Problem ist nicht, dass Nachhaltigkeit oder Gerechtigkeit unwichtig wären. Das Problem ist, dass Knappheit nicht verschwindet, nur weil wir sie aufrufen. Jede Palette, jede Arbeitsstunde und jeder Cent, der einem Ziel gewidmet wird, wird einem anderen entzogen. Wie ich im Buch feststelle: Das Aufrufen eines höheren Zwecks “löst Knappheit nicht auf; es benennt Abwägungen nur um … es gibt keine Alternative zu Gewinnen und Verlusten.”
Wenn Kohlenstoffemissionen eine Rolle spielen, müssen sie als Kosten in die Kalkulation einfließen – durch CO2-Preise, Regulierungen, Kundenverhalten oder Markenrisiken – damit alternative Entscheidungen in einer gemeinsamen Einheit vergleichbar sind. Wenn Gerechtigkeit zählt, müssen wir angeben, wessen Gerechtigkeit, zu welchem Preis und mit welchen Konsequenzen, wiederum so, dass dies in Entscheidungen einfließt und später geprüft werden kann. Andernfalls schmücken wir die Diskussion lediglich mit Adjektiven.
Dennoch begnügt sich das AI Era-Vision-Papier damit, zu erklären, dass supply chains “müssen” nachhaltig und gerecht sein, ohne jemals zu spezifizieren, was diese Begriffe operativ bedeuten, wer dafür aufkommt und in welchem Umfang. Im Gesundheitssektor beispielsweise heißt es, dass Liefer-supply chains unter “strengen Sicherheits- und Gerechtigkeitsvorgaben” operieren müssen. Ethik mag das zwar beruhigend klingen; was supply chains angeht, ist es inhaltsleer. Wie sicher ist “sicher genug”? Gerechtigkeit für welche Patientengruppen, zu welchen Kosten hinsichtlich entgangener Durchlaufmengen und im Vergleich zu welchen Alternativen? Keine Zahlen, keine Preise, keine Abwägungen.
Schlimmer noch, das Papier präsentiert diese supra-ökonomischen Ziele als eine Verantwortung der OM-Community gegenüber den Bilanzen anderer. Es ist eine Sache, wenn ein Parlament nach demokratischer Debatte Steuern oder Sicherheitsstandards festlegt. Eine ganz andere ist es, wenn Akademiker Managern vorschreiben, dass sie verpflichtet sind, “gerechte” supply chains zu entwerfen, ohne ausdrücklich zu quantifizieren, von wem und wem umverteilt wird. Ersteres ist Politik; Letzteres ist bestenfalls Paternalismus und schlimmstenfalls eine stille Aufforderung, die treuhänderische Pflicht gegenüber Aktionären, Anleihegläubigern, Mitarbeitern und Kunden zu verraten, die möglicherweise nicht dieselben Prioritäten teilen.
Sobald man akzeptiert, dass jede Sache supra-ökonomische Priorität beanspruchen kann, gibt es kein begrenzendes Prinzip mehr. Wie ich im Buch anmerke, ist die Geschichte übersät mit Unternehmen, die sich enthusiastisch mit später als katastrophal erkannten Anliegen identifizierten – von offen diskriminierenden Einstellungsverfahren bis hin zu wohltätiger Unterstützung von Eugenik – damals bewaffnet mit einem beeindruckenden “wissenschaftlichen Konsens”. In jedem Fall wurde die ökonomische Kalkulation der supra-ökonomischen Rhetorik untergeordnet; in jedem Fall wurden Ressourcen verschwendet, die besser zur Bedienung der Kunden hätten eingesetzt werden können.
Supra-ökonomisches Tugend-Signalisieren ist kein harmloser Schnörkel. Es ist ein ethisches Versagen an sich, weil es die Urteilsfähigkeit über Abwägungen trübt, während es Ressourcen ausgibt, die nicht den Autoren zur Verfügung stehen. Eine “Vision” für supply chain, die mit solchem Signalisieren beginnt und endet, lehrt die nächste Generation von Praktikern, dass sie für Adjektive optimieren sollten, statt für die harten währungsgebundenen Konsequenzen, die ihre Entscheidungen haben werden.
Rahmen, Ebenen und der Anschein von Tiefe
Das zweite Kennzeichen dieses Papiers ist seine Vorliebe für Rahmenkonzepte und Verweise.
Nach dem Abstract kündigen die Autoren an, dass sie ihre Diskussion um fünf “Ebenen” der Interaktion zwischen KI und supply chain management strukturieren werden: Intelligence, Execution, Strategy, Human und Infrastructure. Jede Ebene erhält daraufhin einen eigenen Abschnitt, und der Rest des Papiers ist um diese Klassifikation herum organisiert.
An sich ist an Taxonomien nichts grundlegend falsch. Die Frage ist immer: Welche Entscheidungen ändern sich dadurch, dass wir nun diese bestimmte Taxonomie anstelle einer anderen haben? Wenn wir morgen die fünf Ebenen zu drei zusammenfassen oder in acht aufteilen würden, wäre eine einzelne Bestellung, ein Transfer oder ein Preis anders? Die Autoren versuchen niemals, diese Frage zu beantworten. Der Rahmen fungiert als Aktenschrank für bereits vorhandene Ideen; er wird nicht zu einem Instrument der Entscheidungsfindung.
Praktiker haben diesen Film schon zuvor gesehen. In Introduction to Supply Chain widme ich einigen Seiten der Frage, wie “Planning” in den 1990er Jahren zum Marketing-Flaggschiff für Enterprise-Systeme wurde, selbst wenn diese wenig mehr enthielten als Zeitreihenprognosen und grundlegende Sicherheitsbestandformeln. ERP-Anbieter, gefolgt von APS-Anbietern, umetikettierten generische Buchhaltungsprozesse als “integrated planning”, dann “advanced planning” und, in jüngerer Zeit, “digital twins” und “control towers”. Die Terminologie änderte sich; die zugrundeliegenden Tabellen und Verwaltungsabläufe taten es nicht.
Die fünfstufige Architektur in diesem Papier fühlt sich an wie eine weitere Umdrehung dieses Rades. Sie erweckt den Eindruck von Tiefe, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass sie zu anderen Entscheidungen, besserer Automatisierung oder verbesserten wirtschaftlichen Ergebnissen führt. Eine Taxonomie, die nicht verändert, was auf dem Lagerboden oder im Auffüllbetrieb geschieht, ist aus der Sicht des Praktikers eher ein Schmuckelement als ein Fortschritt.
Das Gleiche gilt für die Literaturliste und deren Verwendung. Das Papier betont, dass es aus einem “umfassenden kollaborativen Prozess” hervorging, an dem 42 Forscher, Praktiker und Technologieführende beteiligt waren, von denen viele auch zum kommenden Buch der Autoren AI in Supply Chains: Perspectives from Global Thought Leaders beitragen. Die Zitationen stützen sich dann stark auf denselben Kreis: Mehrfache Verweise auf Cohen, Dai, Perakis und ihre Co-Autoren sowie ein Bündel jüngster Working Papers und in Druck befindlicher Artikel des Autorenteams.
Auch an sich ist es nicht illegitim, auf die eigene Arbeit zu verweisen. Das Problem ist, dass die schiere Breite der Liste als eine Art Beweis an sich dargestellt wird. Den Praktikern wird ein Reigen von Titeln präsentiert – “How machine learning will transform supply chain management”, “Using AI to detect panic buying”, “Large language models for supply chain optimization” – ohne dass ihnen gesagt wird, wie eines dieser Werke sich verhält, wenn es auf umfangreiche, chaotische Unternehmensdaten angewendet wird, unbeaufsichtigte Entscheidungen trifft und an tatsächlichen Gewinnen und Verlusten gemessen wird.
Wenn Sie ein Netzwerk von Fabriken und Lagern betreiben, ist es Ihnen egal, wie viele Papiere es zu einem Thema gibt. Entscheidend ist, ob es ein numerisches Rezept gibt, das Sie unter Ihren Bedingungen auf Ihre Daten anwenden können und das die morgigen Bestellungen, Transfers und Preise in monetären Werten besser macht als die gestrigen. Dafür ist eine gut dokumentierte Feldimplementierung, mit vollständigen wirtschaftlichen Ergebnissen und klaren Grenzen, mehr wert als ein Dutzend Vision Statements und fünfzig Zitationen.
Das AI Era-Papier bietet Ersteres nur in flüchtiger, anekdotischer Form. Ein Abschnitt über “Optimal Machine Learning” erwähnt zwei Fortune-150 Fallstudien, in denen ein Beratungsunternehmen angeblich die Servicelevels verbessert und die Lagerkosten reduziert hat. Dem Leser werden keine Ausgangswerte, keine kontrafaktischen Vergleiche, keine Details über das eingesetzte Gesamtkapital oder das Risikoprofil vor und nachher vermittelt. In anderen branchenspezifischen “Spotlights” wird berichtet, dass JD.com ein starkes Analytics-Team aufgebaut und KI genutzt hat, um Prognosen dem Management zu erklären, oder dass humanitäre Organisationen KI für eine bessere Vorpositionierung von Beständen einsetzen können. All dies mag wahr sein; nichts davon geht über das Niveau einer Marketingbroschüre hinaus.
Von außen sieht es aus wie ein geschlossener Kreis: ein Zirkel von Autoren, die einander und ihre Studenten zitieren zur Unterstützung eines Frameworks, auf das sie sich bereits geeinigt haben, mit der gelegentlichen Einstreuung einer Praktiker-Geschichte obendrauf. Für Akademiker mag dies ein Signal für Aktivität in einem Feld sein. Für Praktiker signalisiert es, dass ihnen hier nichts dabei helfen wird, zu entscheiden, wie viel sie in der nächsten Woche einkaufen sollen.
KI, Prognose und das alte Planungsgleichgewicht
Das Herzstück des Papiers – die “Intelligence Layer” – widmet sich der KI an sich. Hier beschreiben die Autoren, wie Machine Learning die Prognosegenauigkeit verbessert, wie Reinforcement Learning zur Bestandskontrolle eingesetzt werden kann, wie ein aufkommendes Paradigma namens “decision‑focused AI” Optimierungsziele in die Verlustfunktion einbettet und wie Large Language Models (LLMs) möglicherweise natürliche Sprachschnittstellen und “agentic reasoning via chain‑of‑thought” für komplexe supply chain Probleme bieten könnten.
Vieles davon ist in einem engen Sinn technisch korrekt. Machine Learning kann in der Tat viele Merkmale einbeziehen; Reinforcement Learning kann tatsächlich Richtlinien unter Simulation erlernen; LLMs können Texte rund um Optimierungsmodelle parsen und generieren. Die Frage ist nicht, ob diese Werkzeuge existieren; sie lautet, ob ihre Nutzung, wie im Papier dargestellt, die tatsächlichen strukturellen Schwächen des Planungsparadigmas in supply chain adressiert.
Das tut sie nicht.
Prognosen sind ein gutes Beispiel. Die Autoren schreiben, dass Machine Learning “die Prognosegenauigkeit verbessert” und dass fortgeschrittene Nachfragevorhersagen sich auf “hundertfach dynamische Variablen aus internen und externen Datensätzen” stützen können. Später, in ihrer Diskussion über decision‑focused AI, erkennen sie an, dass traditionelle “predict‑then‑optimize”-Pipelines Vorhersage und Entscheidung nicht in Einklang bringen können und schlagen vor, Modelle direkt anhand der nachgelagerten Entscheidungskosten zu trainieren.
All dies wird so dargestellt, als ob das grundlegende Problem bei der supply chain Prognose der Mangel an Raffinesse in den Zeitreihenmodellen sei. Das ist es nicht.
In meinem Buch widme ich einen ganzen Abschnitt der Frage, warum das Zeitreihen-Paradigma strukturell ungeeignet für Geschäftsentscheidungen ist. Eine Zeitreihe fasst eine Historie von Transaktionen zu einer Zahlenfolge zusammen, die nach Zeitintervallen indexiert ist. Diese Darstellung ist in wesentlichen Aspekten verlustbehaftet. Zwei Nachfragestrukturen können identische wöchentliche Verkaufsreihen erzeugen – eine, in der tausend unabhängige Kunden jeweils eine Einheit pro Woche kaufen, und eine, in der ein einzelner Großkunde alle tausend Einheiten kauft. Im ersten Fall kollabiert die Nachfrage langsam; im zweiten Fall kann sie über Nacht zusammenbrechen. Die wöchentliche Zeitreihe unterscheidet zwischen ihnen nicht, aber das Inventarrisiko ist grundlegend unterschiedlich.
Ebenso könnte ein Produkt, das zehn Einheiten pro Woche verkauft, entweder zehn kleine Warenkörbe oder einen großen Warenkorb darstellen. Die Zeitreihe ist identisch; die sinnvolle Lagerposition unterscheidet sich jedoch um den Faktor vier oder mehr. Zeitreihen-Prognosen, so ausgeklügelt sie auch sein mögen, können nicht Informationen wiederherstellen, die die Aggregation selbst zerstört hat. Es geht nicht darum, mehr Merkmale hinzuzufügen oder tiefere Netzwerke zu verwenden; die Darstellung ist für die Entscheidung falsch.
Das Papier setzt sich nie mit dieser strukturellen Kritik auseinander. Es nimmt einfach an, wie zahllose Arbeiten zuvor, dass eine bessere Zeitreihenprognose ein zentrales Engpass im supply chain ist und dass maschinelles Lernen die natürliche Antwort ist. Der kurze Hinweis auf entscheidungsfokussierte Verluste ist inkrementell: Die Modelle optimieren nun eine relevantere Verlustfunktion, aber sie werden immer noch auf demselben verarmten Objekt trainiert.
Schlimmer noch, wenn das Papier spezifische Entscheidungskriterien anspricht, greift es zu den üblichen Verdächtigen: service levels und Lagerkosten. OML wird dafür gelobt, in Fallstudien die service levels „signifikant“ zu verbessern und die Lagerkosten zu senken. Die zugrunde liegende ökonomische Frage – wie viel Kapital welchen Optionen bei welchem Risikoprofil zugewiesen werden sollte – wird nie explizit formuliert.
Im Buch nenne ich Sicherheitsbestand-Formeln „hazardous stocks“ und stelle fest, dass sie einen Lackmustest für grobe Inkompetenz im supply chain liefern. Diese Formeln beruhen darauf, ein Ziel-service level – sagen wir 95% – zu wählen und diesen Prozentsatz so zu behandeln, als ob er eine intrinsische Verbindung zum Gewinn hätte. Das tut er nicht. Das service level ist ein Stellvertreter für einen bargeldlichen Kompromiss zwischen Ausfallkosten und Lagerhaltungskosten. Wenn wir nicht beide Seiten bepreisen und den Trade-off explizit berechnen, ist das Zielen auf „95%“ oder „97%“ reine Numerologie. Wie ich auch anmerke, ist das service level zu einem klassischen „escapee“ KPI geworden: ein Stellvertreter, der sich von seinen ökonomischen Wurzeln gelöst hat und nun die Organisation dominiert, während niemand gezwungen ist, tatsächliche Preise anzugeben.
Das AI Era-Papier hinterfragt diese KPI-Kultur niemals; es bettet AI darin ein. Die Prognosen werden verbessert; Lagerhaltungsrichtlinien können angepasst werden; service levels werden etwas höher und Lagerbestände etwas niedriger – und uns wird gesagt, dass dies Fortschritt sei. Es wird nicht erwähnt, wie risikoadjustierte Renditen, wie Optionen im Hinblick auf eine Working-Capital-Beschränkung bewertet werden oder wie die Modellleistung an der Grenze beurteilt wird, an der Empfehlungen in das ERP zurückgeschrieben werden und tatsächlich Geld fließt.
Die Behandlung von großen Sprachmodellen ist ein weiteres Beispiel. Das Papier suggeriert, dass LLMs „versprechen, fortschrittliche Planungstools zugänglicher zu machen“ und natürliche Sprachschnittstellen bieten können, die „den Zugang zu fortschrittlichen Entscheidungswerkzeugen demokratisieren“.
Im Buch argumentiere ich, dass Sprachmodelle im Allgemeinen Größenordnungen mehr Rechenleistung verbrauchen als spezialisierte Algorithmen, die dieselbe Aufgabe erfüllen, und dass sie im Bereich der numerischen Datenverarbeitung kaum konkurrenzfähig sind. Ihre angemessene Rolle im supply chain ist eng gefasst: Sie beschleunigen das Verfassen und die Pflege numerischer Rezepte und Dokumentationen sowie das Extrahieren von Merkmalen aus unstrukturiertem Text. Ihre Verwendung als Prognose-Engines ist ausdrücklich fehlgeleitet: Sie sind „ungeeignet für Zeitreihenprognosen – oder numerische Arbeiten jeglicher Art“ und schneiden im Vergleich zu grundlegenden statistischen Modellen bei hohen Kosten schlecht ab.
Das Vision-Papier greift erneut den Trend auf: LLMs werden zu „agenturischen“ Problemlösern, die dabei helfen können, Reinforcement-Learning-Richtlinien abzustimmen und mittels chain‑of‑thought über komplexe supply chain Entscheidungen zu sinnieren. Es wird nicht ernsthaft über numerische Zuverlässigkeit, Kosten oder den grundlegenden Punkt diskutiert, dass stochastische Textgeneratoren eine sehr schlechte Grundlage für unbeaufsichtigte Verpflichtungen darstellen, bei denen Millionen von Dollar an Inventory im Spiel sind.
Ohne seinen AI-Schleier bietet das Papier dasselbe Planungsgleichgewicht, das seit Jahrzehnten dominiert: Prognosen als Zeitreihen, Pläne als Bündel von Zeitreihen, service levels als Talismanen und Menschen, die die Ergebnisse validieren. AI wird eingeladen, als Verstärker an der Spitze dieses Stapels zu sitzen – nicht, um dessen Grundlagen in Frage zu stellen.
Warum Praktiker wegsehen werden (und sollten)
Nichts von alledem hätte große Bedeutung, wäre das Papier lediglich ein akademisches Konstrukt. Aber es ist explizit als Leitfaden für Praktiker und Lehrende konzipiert. Die Autoren schließen mit Appellen an Forscher, Branchenführer und Universitäten und fordern sie auf, Lehrpläne rund um die Mensch‑AI-Kollaboration zu entwickeln, Governance-Rahmenwerke für „ethische“ AI-Einsätze zu erarbeiten und supply chains zu gestalten, die „Resilienz, Produktivität und gesellschaftliches Wohl“ fördern.
Das Problem ist, dass das zugrunde liegende Denkmodell niemals den Komfort des Seminarraums verlässt.
Es wird nicht darauf bestanden, dass Techniken an vollumfänglichen, chaotischen Unternehmensdaten getestet werden, die unbeaufsichtigte Entscheidungen hervorbringen und an einer in Bargeld messenden Basis beurteilt werden. Es wird nicht darauf bestanden, dass überökonomische Bedenken in Preise, Regulierungen oder quantifizierte Risiken übersetzt werden, bevor sie zulassen, dass der Profit außer Kraft gesetzt wird. Es wird nicht darauf bestanden, dass Rahmenwerke durch die konkreten Veränderungen rechtfertigt werden, die sie in Bezug auf Emissionen bewirken – was gekauft, bewegt und bepreist wird – und nicht durch die Anzahl der Folien, die sie füllen können.
In Kapitel 6.2 meines Buches, wenn ich über allgemeine Intelligenz und die Rolle von Software im supply chain spreche, weise ich darauf hin, dass viele veröffentlichte Modelle die entscheidenden Gestaltungsentscheidungen – Zielsetzung, Einschränkungen, zulässige Optionen – als implizit behandeln. Sie operieren innerhalb ordentlicher, abgegrenzter Rätsel, während sie den chaotischen Teil, für den Unternehmer tatsächlich bezahlt werden, außen vor lassen. Das Heilmittel ist konzeptionell einfach, wenn auch in der Praxis schwer umzusetzen: Formuliere das ökonomische Ziel in monetären Begriffen, liste die zulässigen Optionen auf, definiere Abbruchbedingungen und zerlege die Arbeit in abgegrenzte Teilprobleme, die Maschinen lösen können.
Die AI Era-Visionserklärung tut dies nicht. Sie beginnt mit unbepreisten Adjektiven, häuft eine Klassifikation auf, durchforstet eine Literatur, die größtenteils von ihren eigenen Autoren und deren Kollegen verfasst wurde, und fordert dann mehr vom Gleichen unter dem Banner von AI. Sie ist eloquent, ernsthaft und für alle, die versuchen, eine supply chain zu betreiben, fast völlig am Thema vorbeigehend.
Deshalb ignorieren Praktiker diese Art von Arbeit. Nicht, weil sie anti‑intellektuell wären, sondern weil sie – oft auf die harte Tour – gelernt haben, dass Rahmenwerke ohne Zielfunktionen, Prognosen ohne eine ehrliche Diskussion über Repräsentationsgrenzen, AI ohne einen ökonomischen Maßstab und Ethik ohne Preise alle zum gleichen Ergebnis führen: beeindruckende Foliensätze, bescheidene Pilotprojekte und keinen nachhaltigen Anstieg der Kapitalrendite des Unternehmens.
Wenn die Wissenschaft im supply chain wieder eine Rolle spielen will, muss sie das von diesem Papier so eindeutig dargestellte Muster umkehren. Beginnen Sie mit der Ökonomie, nicht mit Adjektiven. Übersetzen Sie Anliegen – seien sie umweltbezogen, sozial oder anderweitig – in explizite Abwägungen anstelle moralischer Parolen. Beurteilen Sie Modelle nach ihrer Leistung bei chaotischen Daten, unter realen Einschränkungen, mit unbeaufsichtigten Entscheidungen und echtem Geld im Spiel. Akzeptieren Sie, dass Zeitreihenplanung für viele Probleme eine Sackgasse ist und dass AI nicht der magische Dünger für ein fehlerhaftes Paradigma darstellt.
Bis dahin sind Praktiker nicht nur berechtigt, solche Visionserklärungen zu ignorieren. Sie handeln umsichtig.


