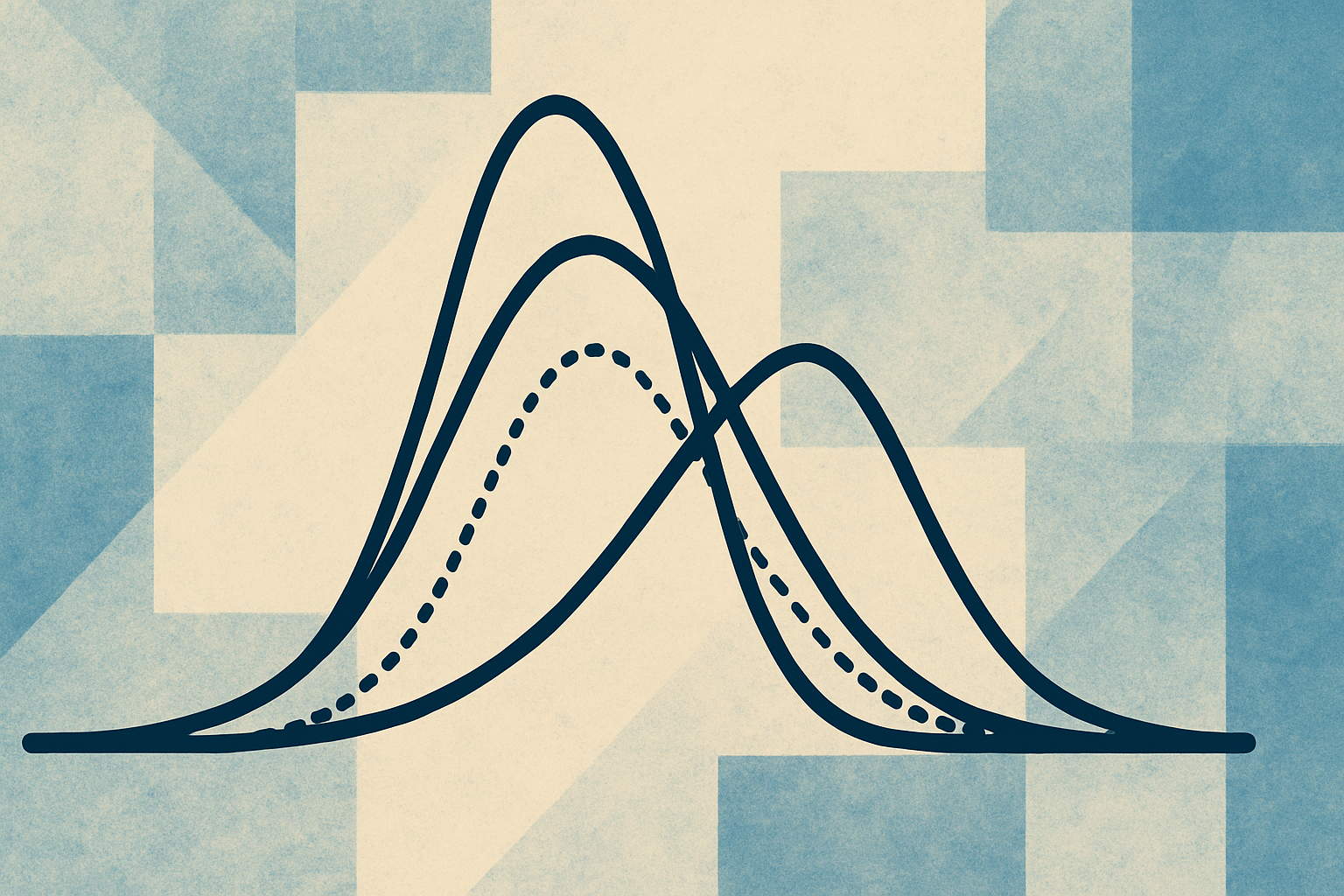Supply Chain Resilienz neu überdacht
In den letzten Jahren ist „Resilienz“ zu einem dieser Wörter geworden, die Führungskräfte in nahezu jedem zweiten Satz zu verwenden glauben. Nach jeder Unterbrechung – sei es ein Lockdown, ein Krieg oder ein blockierter Kanal – stellt sich immer dieselbe Frage: „Wie machen wir unsere supply chain widerstandsfähiger?“ Die Gespräche sind ernst gemeint; die Antworten bleiben oft vage. „Mehr Transparenz“, „mehr Zusammenarbeit“, „mehr Agilität“ – Wörter, die zwar positiv klingen, aber kaum erklären, was wir täglich anders tun sollten, wenn wir entscheiden, was wir einkaufen, herstellen, transportieren und bepreisen.

In meinem Buch Introduction to Supply Chain, habe ich eine Sichtweise vorgestellt, die supply chain als diszipliniertes Management von Entscheidungen unter Unsicherheit versteht – mit Wirtschaftlichkeit als primärem Maßstab, nicht Servicelevels oder Auslastung. Diese Sichtweise hat meine Auffassung von Resilienz geprägt. Tatsächlich hat sie mich zu einer Definition geführt, die weitaus enger gefasst ist, als man sie typischerweise in Lehrbüchern, Beratungsbroschüren oder Zertifizierungsprogrammen findet.
Was ich unter „Resilienz“ verstehe
Wenn ich von supply chain Resilienz spreche, meine ich etwas sehr Spezifisches.
Ein Unternehmen – und seine supply chain – gilt als resilient, wenn es in der Lage ist, einen ungeplanten, systemischen Schock, der den Fluss von Gütern bedroht, zu überstehen und diesen anschließend in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen.
In diesem Satz gibt es zwei wichtige Einschränkungen.
Der erste Punkt ist „ungeplant.“ Viele unangenehme Ereignisse sind in diesem Sinne keine Schocks. Ein saisonaler Nachfrageanstieg, eine Promotion, die besser funktioniert als erwartet, oder die Tatsache, dass Lieferzeiten variabel und nicht konstant sind – all dies ist weder neu noch mysteriös. Es mag schwierig sein, es präzise zu modellieren, doch liegt es nicht außerhalb des Rahmens vernünftiger Erwartung. Wenn an jedem Weihnachten die Bestände ausgehen, handelt es sich nicht um ein Resilienzproblem, sondern um ein Planungsproblem.
Die zweite Einschränkung lautet „systemisch.“ Ein einzelnes Geschäft, das seinen Strom verliert, ein LKW, der ausfällt, oder ein Lieferant, der eine Lieferung versäumt – das sind lokale Vorkommnisse. Sie können ärgerlich oder sogar kostspielig sein, bedrohen jedoch nicht die Gesamtkontinuität des Flusses. Ein großer Hafen, der monatelang geschlossen bleibt, ein regulatorischer Schock, der eine Kategorie plötzlich unverkäuflich macht, oder ein Krieg, der ganze Handelsrouten in einer Region lahmlegt – hier bewegen wir uns im systemischen Bereich.
Resilienz, so wie ich den Begriff verwende, ist genau diesen seltenen, folgenreichen Ereignissen vorbehalten, die (a) nicht im Detail vernünftigerweise geplant werden konnten und (b) einen erheblichen Teil der supply chain auf einmal betreffen.
Alles andere – der tägliche Rausch der Nachfrage, die Unregelmäßigkeiten der Lieferzeiten, der übliche Tanz der Promotionen, die vorhersehbaren Eskapaden der Wettbewerber – sollte durch gute supply chain-Praxis gelöst werden und nicht als „Resilienz“ deklariert werden.
Wie der Mainstream über Resilienz spricht
Betrachtet man, wie große Technologieanbieter, Berufsverbände und politische Organisationen Resilienz beschreiben, ergibt sich ein anderes Bild.
Eine recht typische Definition beschreibt supply chain Resilienz als die Fähigkeit, Störungen vorauszusehen, sich an diese anzupassen und sich von ihnen zu erholen, während der Betrieb ungestört weiterläuft. Der Schwerpunkt liegt auf Kontinuität: Das System sollte weiterhin akzeptable Servicelevels liefern, selbst wenn etwas Unerwartetes passiert.
Die wichtigsten Berufsverbände fügen eine weitere Nuance hinzu: Resilienz ist die Fähigkeit, nach einer von den Erwartungen abweichenden Leistung wieder in einen Zustand des Gleichgewichts zurückzufinden. In dieser Betrachtung geht es darum, nach einer Störung wieder zum „Normalzustand“ zurückzukehren – was durch mehr Reaktionsoptionen und schnelles Handeln verbessert werden kann.
Daraus ergibt sich immer wieder eine bekannte Liste von Hebeln. Redundanz in Form von zusätzlichem Inventar, Reservekapazitäten und alternativen Lieferanten. Flexibilität durch vielseitig einsetzbare Arbeitskräfte und anpassungsfähige Produktion. Sichtbarkeit und Zusammenarbeit, oft ermöglicht durch digitale Plattformen, um Probleme früher zu erkennen und koordinierte Reaktionen zu ermöglichen. Neuere politische und beratende Berichte fügen eine weitere Ebene hinzu: die Notwendigkeit, Effizienz und Resilienz auszubalancieren – manchmal durch die Umstrukturierung von Netzwerken, die Anpassung der Beschaffungsstrategien oder Investitionen in neue Technologien. Akademische Übersichten, insbesondere aus der Perspektive des Bestandsmanagements, ordnen Strategien wie Vorratshaltung, Multi-Sourcing, Kapazitätsreservation und flexible Vertragsgestaltungen unter dem Begriff „Resilienzstrategien“ ein.
An dieser Mainstream-Sichtweise ist nichts Absurdes. Die benannten Hebel sind real; ebenso die aufgezeigten Zielkonflikte. Meine Sorge ist, dass dieses Vokabular dafür sorgt, dass Resilienz zu einem freundlichen Schicklabel wird, das man fast jedes Verbesserungsprojekt anheften kann: Mehr Inventar? Das ist Resilienz. Weniger Inventar, aber an „besseren“ Orten? Auch Resilienz. Ein neues Dashboard? Resilienz. Ein neuer Prozess? Wieder Resilienz.
Wenn ein Wort anfängt, alles zu bedeuten, was nach einer guten Idee klingt, verliert es rasch seinen Mehrwert.
Warum ich auf einer schärferen Abgrenzung bestehe
Ich ziehe eine klare Grenze zwischen dem Bereich der Resilienz und dem Bereich der gewöhnlichen supply chain-Exzellenz, weil diese von unterschiedlichen Wissensformen beherrscht werden.
Der Großteil dessen, womit ein supply chain-Team konfrontiert ist, ist unsicher, aber nicht mysteriös. Die Nachfrage variiert – in einer Weise, die, wenn auch unvollkommen, aber nützlich, durch statistische Modelle erfasst werden kann. Die Lieferzeiten sind schwankend, aber ihre Variabilität lässt sich messen. Promotionen, Preisänderungen, Sortimentsanpassungen, Kalenderereignisse: All dies verleiht der Unsicherheit eine Struktur. Vielen dieser Muster können wir Wahrscheinlichkeiten und wirtschaftliche Konsequenzen zuordnen.
In diesem Kontext lautet die richtige Frage nicht: „Wie werden wir resilient?“ Vielmehr lautet sie: „Angesichts dessen, was wir über die Verteilungen von Nachfrage, Lieferzeiten und Preisen wissen, welche wirtschaftlich beste Entscheidung treffen wir heute?“ Eine gute Entscheidung ist in diesem Sinne eine Wette: Sie wägt mögliche Ergebnisse und ihre finanziellen Auswirkungen ab. Sie akzeptiert, dass wir an manchen Tagen verlieren werden, hält diese Verluste jedoch klein und tragbar.
Wenn wir jedes Versäumnis, dies richtig zu machen, als ein „Resilienzproblem“ etikettieren, entschuldigen wir viel vermeidbare Fragilität. Eine Sicherheitsbestandsregel, die die Unsicherheit der Lieferzeiten außer Acht lässt, wird nicht automatisch respektabel, nur weil wir sagen, sie sei Teil einer Resilienzstrategie. Ein Nachfüllprozess, der mit Promotionen nicht zurechtkommt, leidet nicht an einem Resilienzversagen – er ist schlichtweg schlecht konzipiert.
Resilienz, so wie ich den Begriff verwende, beginnt erst dort, wo ein probabilistisches, wirtschaftsorientiertes Denken nicht mehr ausreicht – dort, wo Ereignisse eintreten, die außerhalb des Repertoires von Mustern liegen, das unsere Modelle, Erfahrungen und Daten vernünftigerweise abdecken können.
Entscheidungen als Wetten und warum das bei Schocks eine Rolle spielt
Selbst wenn es nicht um Schocks geht, ist jede supply chain-Entscheidung eine Wette auf die Zukunft. So nehmen wir es selten wahr, weil die Entscheidungen zahlreich und sich wiederholend sind: hier eine Nachbestellung, dort ein Produktionslauf, ein LKW, der geroutet werden muss, ein Preis, der anzupassen ist. Hinter jeder dieser Maßnahmen verbirgt sich jedoch eine implizite Vorstellung davon, was passieren könnte und wie kostspielig jedes Ergebnis wäre.
Was mich interessiert, ist die Gestalt dieser Wette.
Viele Organisationen gestalten ihre Prozesse – oft unbewusst – so, dass Entscheidungen extrem empfindlich auf eine enge Zukunftsvorstellung reagieren. Eine Prognose wird als eine einzelne Zahl betrachtet. Servicelevels gelten als heilige Schwellenwerte. Die Kapazität wird nahezu bis zur Sättigung ausgelastet. Mindestbestellmengen und starre Vorgaben binden frühzeitig große Verpflichtungen. Solange sich die Welt annähernd wie erwartet verhält, erscheint dies effizient: die Bestände sind niedrig, die Auslastung hoch, die Kosten sehen gut aus.
Sobald die Realität abweicht – und das tut sie immer, selbst ohne Lockdown oder Krieg – erweisen sich diese Entscheidungen als brüchig. Eine bescheidene Nachfrageüberraschung, eine geringfügige Lieferverzögerung oder eine kleine regulatorische Änderung breitet sich im Netzwerk auf unerwartete Weise aus, weil die zugrunde liegenden Wetten keinen Spielraum für Abweichungen vorsahen.
Aus meiner Sicht geht es bei Resilienz nicht in erster Linie darum, was man nach einem Schock tut, sondern um den Aufbau der Wetten, die man vorher abschließt. Eine supply chain, die systematisch brüchige Wetten eingeht, wird nicht plötzlich resilient, wenn etwas Ernsthaftes passiert. Im Gegenteil, eine supply chain, die Unsicherheit konsequent richtig bepreist – die dort Spielraum akzeptiert, wo dieser günstig ist, und schädliche Engpässe dort toleriert, wo sie wirtschaftlich vertretbar sind – wird oft selbst unter Druck anmutig reagieren.
Deshalb betrachte ich Resilienz als einen Nebeneffekt disziplinierter Entscheidungsfindung unter Unsicherheit und nicht als eine separate Schicht von Prozessen und Dashboards.
Bandbreite, Automatisierung und der menschliche Faktor
Ein weiterer, stärker menschlicher Aspekt, der oft übersehen wird, ist die Bandbreite der Menschen, die sich um Resilienz kümmern sollen.
In vielen Unternehmen leben supply chain-Teams in einem Zustand ständigen Feuerlöschens. Sie gleichen unstimmige Daten aus mehreren Systemen ab, überschreiben manuell Pläne, die keinen Sinn ergeben, springen von einer Ausnahme zur nächsten und nehmen an endlosen Meetings teil, um die Probleme von gestern zu erklären. Die Werkzeuge, die ihr Leben vereinfachen sollten, erzeugen stattdessen den Großteil des Lärms, den sie zu bewältigen haben.
In einem solchen Umfeld – wer hat da schon die Zeit oder die geistige Energie, sich ernsthaft mit selten auftretenden, jedoch folgenreichen Schocks auseinanderzusetzen? Die Agenda ist völlig von Problemen ausgefüllt, die sowohl dringend als auch selbstverschuldet sind.
Meine Auffassung ist, dass jede glaubwürdige Resilienzagenda damit beginnt, diese Bandbreite freizusetzen. Das bedeutet, den Großteil der Routineentscheidungen zu automatisieren – nicht mit simplen Regeln, sondern mit quantitativen Engines, die Unsicherheit und Wirtschaftlichkeit so gut verstehen, dass sie tausende kleine Wetten im Namen der Organisation abschließen können. Wenn Maschinen das übernehmen, worin sie gut sind – also sich wiederholende, datengetriebene Entscheidungen unter stabilen Vorgaben – können Menschen sich auf das konzentrieren, wofür sie einzigartig geeignet sind: das Vorstellen von Ausfallmodi, die noch nicht eingetreten sind, das Hinterfragen von Annahmen und die Entscheidung darüber, welche strukturellen Risiken das Unternehmen zu tragen bereit ist.
Ohne diesen Wandel wäre all das Gerede über Resilienz nur Gerede.
Wo ich mich von der Mainstream-Praxis distanziere
All das führt zu einer leisen, aber bedeutsamen Divergenz zwischen meiner Auffassung von Resilienz und derjenigen, die in den meisten Branchenkonversationen vorherrscht.
Die erste Divergenz betrifft Prognosen und Risiken. In der Mainstream-Praxis wird die Prognose üblicherweise als eine separate, fast heilige Tätigkeit behandelt – als eine einzelne Zahl pro SKU und Periode, gelegentlich untermalt mit Szenarien. Das Risikomanagement setzt dann mit Heatmaps, Registern und Workshops noch drauf. Nach meiner Erfahrung ist diese Trennung künstlich. Unsicherheit ist kein Zusatz, sondern das Rohmaterial jeder Entscheidung. Wenn wir sie in Einzelpunkt-Prognosen komprimieren und dann „Risiko“ an den Rändern anmalen, bereiten wir uns bereits auf fragile Ergebnisse vor.
Die zweite Divergenz betrifft Kennzahlen. Ein Großteil der Resilienz-Literatur wird in Begriffen wie Wiederherstellungszeit, minimal akzeptablen Servicelevels während einer Störung, Expositionsindizes und ähnlichen Key Performance Indicators formuliert. Diese können für die Kommunikation nützlich sein, aber wenn wir sie direkt optimieren, neigen wir dazu, Resilienz als eine abstrakte Tugend zu behandeln, die gesteigert werden muss. Ich bevorzuge eine pragmatischere Frage: Bei einer bestimmten Art von Schock, wie viel Geld würden wir nach unserem aktuellen Design zu verlieren erwarten und wie viel würde es kosten, diesen Verlust um einen bestimmten Betrag zu reduzieren? Sobald wir es so formulieren, verliert Resilienz ihre mystische Aura und wird zu einem Problem der Kapitalallokation.
Die dritte Divergenz betrifft die Redundanz. Viele Resilienz-Playbooks plädieren für zusätzliches Inventar, mehr Lieferanten, mehr Kapazität und weitere Routen als grundsätzlich positiv. Diese Begeisterung teile ich nicht. Manche Form der Redundanz ist außerordentlich wertvoll, andere hingegen reine Verschwendung. Der Unterschied liegt im Optionswert: Was erlaubt uns dieser zusätzliche Lieferant, diese Reservekapazität oder dieser Pufferbestand angesichts von Unsicherheit, was wir sonst nicht erreichen könnten, und wie oft wird diese Option tatsächlich genutzt? Nur wenn wir diese Frage in finanziellen Begriffen beantworten, können wir beurteilen, ob eine bestimmte „Resilienzinvestition“ sinnvoll ist.
Schließlich stellt sich die Frage der Governance. Ein Großteil des Mainstream-Denkens verortet Resilienz in Komitees, Rahmenwerken und Zertifizierungsprogrammen. Diese mögen ihren Platz haben, doch die entscheidenden Weichenstellungen, die Resilienz bestimmen, sind häufig unternehmerischer Natur: ob man die Produktion in einem einzigen hocheffizienten Standort konzentriert oder den Mehraufwand mehrerer Werke in verschiedenen Jurisdiktionen in Kauf nimmt; ob man sich auf eine kleine Zahl hoch optimierter Lieferanten verlässt oder auch Beziehungen zu Alternativen pflegt, die kurzfristig weniger wettbewerbsfähig sind. Dies sind keine technischen Entscheidungen innerhalb der supply chain-Funktion, sondern strategische Entscheidungen darüber, welche Schocks das Unternehmen bereit ist zu tolerieren.
Resilienz, Robustheit und Antifragilität
Es lohnt sich zudem, Resilienz von zwei benachbarten Konzepten zu unterscheiden: Robustheit und Antifragilität.
Ein robustes System ist eines, das von Störungen innerhalb eines bestimmten Bereichs kaum beeinträchtigt wird und weitgehend wie zuvor funktioniert. Ein resilient System erleidet zwar Einbußen, wenn ein Schock eintritt, erholt sich aber. Ein fragiles System hingegen kann sich nicht wieder erholen – der Schock treibt es an einen Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt.
Antifragilität, ein Begriff, den Nassim Nicholas Taleb populär gemacht hat, geht noch einen Schritt weiter: Er beschreibt Systeme, die tatsächlich von Volatilität profitieren. Sie gewinnen an Nutzen aus Unordnung, statt sie bloß zu überleben.
In wettbewerbsintensiven Märkten setzt sich ein antifragiles Verhalten langfristig durch. Unternehmen, die Schocks ausschließlich als Bedrohungen sehen, werden von denen übertroffen, die sie auch als Chancen wahrnehmen – sei es, um notleidende Vermögenswerte zu erwerben, Marktanteile zu verlagern, Konditionen neu zu verhandeln oder Veränderungen zu beschleunigen, die sonst Jahre dauern würden. Die supply chain allein kann ein Unternehmen nicht antifragil machen, doch sie kann diese Haltung entweder ermöglichen oder behindern. Ein Netzwerk, das ständig am Rande des Zusammenbruchs steht, kann bei einer Störung nicht opportunistisch agieren.
Das ist ein weiterer Grund, weshalb ich mich weigere, Resilienz als ein eng begrenztes technisches Gebiet zu behandeln. Irgendwann muss die Diskussion auch das grundlegende Risikoprofil und die Vorstellungskraft des Unternehmens berühren.
Praktische Konsequenzen dieser Sichtweise
Was bedeutet das alles in der Praxis?
Das bedeutet, dass wir, bevor wir groß angelegte „Resilienzprogramme“ starten, zunächst die Grundlagen dafür bereinigen sollten, wie wir unter Unsicherheit Entscheidungen treffen. Verlassen wir uns immer noch auf einzahlige Prognosen und statische Sicherheitsbestandsformeln, die die Variabilität der Lieferzeiten ignorieren? Erzwingen wir starre Beschränkungen – wie willkürliche Mindestbestellmengen oder Voll-Lade-Regeln –, die Optionen dem Einfachheitsgrundsatz willen eliminieren? Messen wir die Leistung in einer Weise, die kurzfristige Effizienzillusionen belohnt und langfristige Fragilität kaschiert?
Das bedeutet, dass wir ernsthaft in Entscheidungsautomatisierung investieren sollten, die ihrem Namen alle Ehre macht: Systeme, die probabilistische Ansichten von Nachfrage, Lieferzeiten und Preisen integrieren und die auf wirtschaftliche Ergebnisse statt auf willkürliche Füllratenziele optimieren. Es geht hierbei nicht darum, ein Dashboard zu kaufen. Es geht darum, Systeme zu entwickeln oder zu übernehmen, die einen großen Teil der täglichen kombinatorischen Arbeitslast übernehmen können, sodass sich menschliche Experten auf strukturelle Fragestellungen konzentrieren können.
Das bedeutet, dass wir die wenigen wirklich systemrelevanten Risiken identifizieren sollten, die für unser Geschäft von Bedeutung sind. Für jeden einzelnen können wir einfache, unangenehme Fragen stellen: Wenn uns dieser Hafen, diese Währung, dieses regulatorische Umfeld oder diese politische Region für ein Jahr nicht zur Verfügung stünde, was würde tatsächlich geschehen? Würden wir überleben, und in welchem Zustand? Wenn die ehrliche Antwort „wir wissen es nicht“ lautet, dann muss die Messung an erster Stelle stehen. Wenn die Antwort „wir wären erledigt“ lautet, müssen wir entscheiden, ob dieses Risiko akzeptabel ist. Falls nicht, wird die Lösung selten ein Gadget sein; es wird eine strukturelle Veränderung bedeuten.
Das bedeutet auch, dass man akzeptieren muss, dass Resilienz einen Preis hat. Eine supply chain, die wirklich widerstandsfähiger ist, wird oft weniger „effizient“ erscheinen an den sehr engen Messgrößen, die wir zu verehren gelernt haben: Sie könnte mehr Puffer beinhalten, mehr Marge mit Partnern teilen oder Fähigkeiten aufrechterhalten, die den Großteil der Zeit untätig erscheinen. Die Frage ist nicht, ob es diesen Preis gibt, sondern ob es angesichts der Schocks, die uns wirklich wichtig sind, wert ist, diesen zu zahlen.
Resilienz, wie ich sie sehe, ist nicht eine neue Schicht von Komplexität, die zu einer bereits überladenen Disziplin hinzugefügt wird. Sie ist die langfristige Konsequenz davon, Unsicherheit und Wirtschaftlichkeit in den kleinen Entscheidungen, die wir täglich treffen, ernst zu nehmen und den Mut zu haben, einige große strukturelle Entscheidungen in vollem Bewusstsein der Schocks zu treffen, die wir nicht ausschließen können.
Wenn wir das Wort „Resilienz“ für diese Schocks vorbehalten und alles andere als gewöhnliche supply chain-Arbeit behandeln, die automatisiert und verbessert werden kann und sollte – ohne großes Aufsehen – gewinnt der Begriff seine Schärfe zurück. Er wird zu etwas, über das wir nachdenken, in das wir investieren und – wenn nötig – bewusst im Hinblick auf andere Ziele abwägen können.
Das ist zumindest die Art von Resilienz, an der ich interessiert bin.