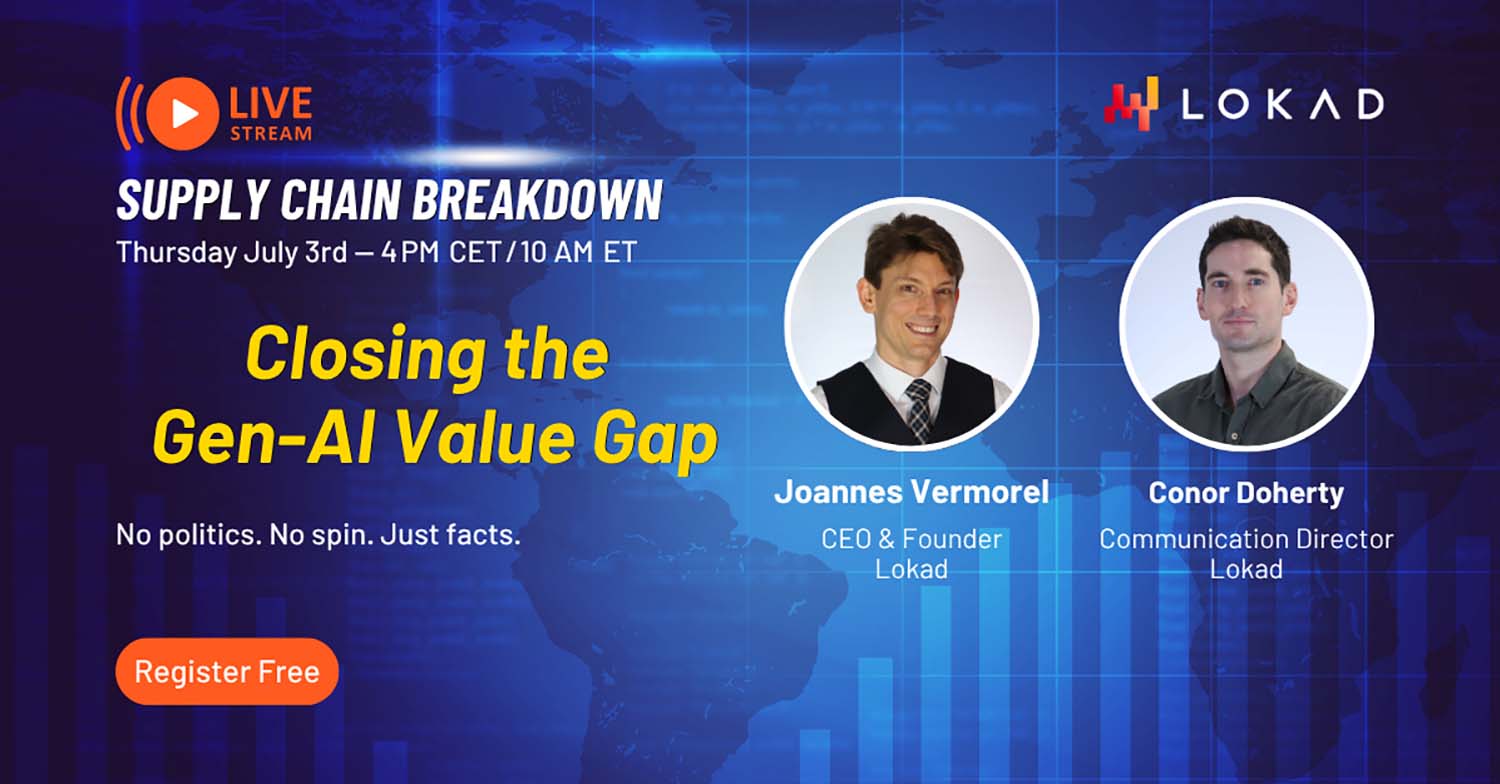Vollständiges Transkript
Conor Doherty: Dies ist Supply Chain Breakdown, und heute werden wir aufschlüsseln, warum du mehr als nur die Nachfrage prognostizieren solltest. Mein Name ist Conor; ich bin hier bei Lokad Kommunikationsdirektor. Und zu meiner Linken im Studio, wie immer, der Lokad-Gründer Joannes Vermorel.
Bevor wir beginnen, zwei Fragen. Erstens, wo schaut ihr zu? Wir sind in Paris. Und zweitens – eine Schlüsselfrage, die die gesamte Diskussion prägt – stimmt ihr zu, dass es wichtig ist, regelmäßig mehr als nur die Nachfrage zu prognostizieren? Eine Schlüsselfrage, die die gesamte Diskussion beeinflussen wird. Wenn dem so ist, seid dabei. Ich weiß, die Zeit drängt heute, also steigen wir gleich ein.
Dieses Gespräch wurde inspiriert durch einen der Vorträge, die ich mir noch einmal angesehen habe – “Durchlaufzeitprognose, Vorlesung 5.3”. Darin hast du argumentiert, und ich zitiere: “Alles, was nicht mit einem angemessenen Maß an Sicherheit bekannt ist, verdient eine Prognose.” Nun, ich kenne dich ein wenig besser als die meisten; ich weiß, dass du glaubst, dass nichts sicher ist außer dem Tod und in Frankreich auf jeden Fall den Steuern. Also, um den Ball ins Rollen zu bringen: Was sind die bekannten Unbekannten – die Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie in der supply chain nicht kennen?
Joannes Vermorel: Wenn man sich die supply chain Literatur anschaut, dreht sich alles um die Prognose von Verkaufszahlen. Ich meine, es gibt buchstäblich tausend Arbeiten zur Vorhersage der Nachfrage – was in der Praxis Zeitreihenprognosen für Verkaufszahlen bedeutet – im Vergleich zur Vorhersage von allem anderen.
Als ich die Literatur untersuchte, ergab sich folgendes Verhältnis: Auf tausend Arbeiten, die sich mit der Prognose von Verkaufszahlen beschäftigen, gab es nur eine, die sich mit der Prognose der Durchlaufzeit befasste. Offensichtlich ist die Durchlaufzeit sehr wichtig. Ich würde sagen, sie ist immer ein bekanntes Unbekannt, denn wenn man eine hohe Servicequalität erreichen möchte, muss man sagen: “Wie lange werde ich diese Anzahl von Kunden bedienen?” Denn je nach deinen Durchlaufzeiten – wenn es beispielsweise sechs Monate dauert, bis die Ware eintrifft, musst du den Bedarf von sechs Monaten abdecken – und wenn der Lieferant in 48 Stunden liefern kann, ist es ein viel kürzerer Zeitraum.
Die Realität ist, dass in nahezu allen Branchen die Zulieferer nicht vollkommen zuverlässig sind. Und das ist nur der erste Punkt—Lieferzeiten sind ganz offensichtlich. Dann gibt es noch die Preise. Es gibt die Preise der eigenen Zulieferer; diese können ihren Preis je nach Marktschwankungen erhöhen oder senken. Außerdem gibt es die Preise der eigenen Wettbewerber, die einem das Handwerk legen können: Ein Wettbewerber kann seinen Preis senken und einen dazu zwingen, ebenfalls den Preis zu senken, oder – umgekehrt, wenn man Glück hat – wenn ein Wettbewerber in Insolvenz geht, kann man seinen Preis erhöhen, weil dadurch eine Stressquelle auf dem Markt wegfällt.
Solche Dinge passieren ständig, und was ich sagen möchte, ist, dass wenn man diese ebenso sehr wesentlichen Quellen der Unsicherheit nicht berücksichtigt, die Entscheidungen in der supply chain – die Zuteilung knapper Ressourcen – stark von der Realität abweichen werden. Es ist wie ein Missmanagement von Risiken. Wenn man festlegt, dass eine bestimmte Risikokategorie nicht existiert, obwohl sie tatsächlich existiert, dann wird jede Berechnung, die man vornimmt, fehlerhaft sein, und das bedeutet mehr Overhead als nötig.
Conor Doherty: Vielen Dank, und ich möchte die Diskussion noch einmal sehr sorgfältig einrahmen. Du hast den Punkt angesprochen, dass du bei der Vorbereitung deiner Vorlesung die Landschaft in der Wissenschaft überprüft und eine enorme Diskrepanz zwischen dem, was über die Nachfrage geschrieben wird, und etwa Lieferzeiten gefunden hast. Okay, das ist die Wissenschaft; in Bezug auf die praktische supply chain Planung ist es sogar noch schlimmer. Wie häufig kommt es vor, dass Menschen Lieferzeiten, Preise, Rückläufer, Ausschussraten prognostizieren – in der Realität, nicht im Klassenzimmer?
Joannes Vermorel: In der Realität sogar unter 0,1%. Wählt man irgendein mittleres ERP, so enthält es ein Modul zur Nachfrageprognose – auch wenn es ein simples ist. Soweit ich weiß, hat so gut wie keines irgendeine Art von Lieferzeitprognose. Eine Preisvolatilitätsanalyse – auch hier, soweit ich weiß – existiert bei keinem.
Wenn man sich die Anwendungsebene anschaut, spiegelt das völlige Fehlen dieser Fähigkeiten buchstäblich die Tatsache wider, dass in wissenschaftlichen Arbeiten dies ebenfalls sehr, sehr stark fehlt. In Enterprise Software kopieren die meisten Anbieter buchstäblich, was in wissenschaftlichen Lehrbüchern zu finden ist. Sie sind nicht unbedingt super erfinderisch, was die Technik angeht; sie neigen dazu, einfach das numerische Rezept aus den großen Lehrbüchern umzusetzen.
Conor Doherty: Wir haben sie nicht zur Verfügung – ich habe vergessen, sie mitzubringen, mea culpa – aber wir haben gestern tatsächlich einige der Lehrbücher in deinem Büro betrachtet, und schon wieder, schon bei einem sehr schnellen Blick in das Inhaltsverzeichnis, um zu versuchen, den Ort zu finden, an dem die Lieferzeitprognose erwähnt wird, findet sich höchstens ein Absatz.
Joannes Vermorel: Sie erwähnen nicht einmal die Lieferzeitprognose. Höchstens erkennen supply chain Fachkräfte an, dass es bestenfalls unterschiedliche Lieferzeiten gibt. Das Höchste, was ich in der Literatur gefunden habe – und ich spreche hier von praktischen Lehrbüchern, nicht von einem zufällig veröffentlichten Paper auf arXiv – war die Annahme, dass Lieferzeiten normalverteilt sind, was sehr seltsam und merkwürdig ist, weil es bedeutet, dass man eine von Null verschiedene Wahrscheinlichkeit dafür annimmt, dass eine Bestellung, die man heute aufgibt, gestern ankommt. Man hat positive Wahrscheinlichkeiten von negativer Unendlichkeit bis positiver Unendlichkeit.
Auf den ersten Blick ist es eine sehr seltsame Herangehensweise bei Lieferzeiten, aber das gibt den aktuellen Stand der Technik dessen wieder, was wir in der Literatur finden können. Wiederum, in der Anwendungsebene in Unternehmen ist dieses Thema einfach völlig abwesend. Normalerweise hat man einfach einen fest codierten Wert für die Lieferzeit, der – wenn man Glück hat – einmal im Jahr überprüft wird; wenn man kein Glück hat, wurde er nie überprüft.
Conor Doherty: Wieder, theoretisch – sagen wir mal zum Zwecke der Diskussion – basiert in den meisten Unternehmen die Planung rein auf der Nachfrageprognose. Was ist daran das Problem? Wenn man sich auf eine einzige Quelle der Unsicherheit konzentriert, wäre die Nachfrage nicht diejenige, auf die man all seine Bemühungen oder zumindest den Großteil seiner Bemühungen richten sollte?
Joannes Vermorel: Denke an jeden anderen Bereich. supply chain sind sehr undurchsichtig, was die Sache kompliziert machen kann, aber stell dir vor, du verkaufst Versicherungen. Ja, du musst beispielsweise bei der Hausbrandversicherung die Wahrscheinlichkeit berücksichtigen, dass das Haus brennt, aber du musst auch die Wahrscheinlichkeit in Betracht ziehen, dass der Kunde bleibt, damit du tatsächlich einen Gewinn erzielen kannst.
Sie müssen diese Unsicherheiten berücksichtigen. Wenn Sie nicht alle berücksichtigen, sind Sie blind. Wie groß sind die Chancen, dass Ihre wirtschaftliche Kalkulation korrekt ausfällt, wenn Sie etwas, das sehr folgenschwer ist, ignorieren? Ich spreche nicht von einem subtilen, schwer fassbaren Muster; ich spreche von etwas, das offensichtlich ist, mit massiven Auswirkungen, wie Vorlaufzeiten oder dem Preis, zu dem Sie verkaufen.
Beispielsweise, wenn ich Produkte mit 90% Bruttomarge verkaufe, weil es ein Zubehörteil ist – die Kunden kümmern sich nicht darum – kann ich bei meinen Überbeständen viel großzügiger sein, da der Verkauf einer Einheit die Kosten von zehn anderen deckt. Wenn ich hingegen als Großhändler mit 2% Bruttomarge verkaufe, sind Überbestände absolut tödlich und ich muss äußerst vorsichtig sein.
Hier machen wir Projektionen über die prognostizierte Bruttomarge, aber es hängt wieder alles vom Preis ab. Wenn Sie dem Preis keine Beachtung schenken, können massive Schwankungen in der Rentabilität auftreten; dies hat dramatische Konsequenzen darauf, ob sich etwas in der Produktion, im Einkauf oder in der Lagerhaltung rentiert.
Conor Doherty: Hier ist es wichtig zu betonen, dass wir im Grunde genommen ein Argument aus dem Risikomanagement bzw. der Wirtschaftstheorie darüber führen, wie wichtig es ist, das Spektrum an Unsicherheiten anzuerkennen.
Joannes Vermorel: Genau. Hier geht es darum, in die Zukunft zu blicken und zu fragen: Was muss ich wissen, was muss ich quantitativ bewerten, um eine evidenzbasierte Entscheidung zu treffen, die für das Unternehmen rational ist?
Die klassische Mainstream-Theorie geht einfach von Zeitreihen der Verkäufe aus und das war’s, und im besten Fall haben sie unglaublich vereinfachte Vorstellungen von der Vorlaufzeit – als wäre sie fix – und das war’s. Abhängig von den Branchen gibt es viele weitere Unsicherheiten. Beim E-Commerce können Retouren auftreten. Wenn Sie in der Textilbranche – Fast Fashion – tätig sind, haben Sie eine Qualitätskontrolle, und ein Teil Ihrer Produktion aus, sagen wir, Bangladesch, könnte die Qualitätskontrolle nicht bestehen. Sie haben also tausend bestellt; am Ende bleiben nur sechshundert, weil vierhundert die Qualitätskontrolle nicht bestanden haben.
Das sind die bekannten Unbekannten. Menschen, die in diesen Branchen arbeiten, wissen das. Wo es verrückt wird, ist, dass der typische Weg, jene Unsicherheiten zu berücksichtigen, die nichts mit der Nachfrage zu tun haben, darin besteht, die Nachfrageprognose rückzuentwickeln, sodass sie indirekt diese andere Unsicherheit berücksichtigt.
Beispielsweise, wenn Sie denken, dass Ihre Vorlaufzeit viel Variabilität aufweist, heben die Leute die Verkaufsprognose an, sodass Sie früher mehr bestellst und damit Ihr Vorlaufzeitrisiko abdecken. Aber das ist ein sehr umständlicher Ansatz, und plötzlich landen Sie in dieser super merkwürdigen Situation, in der eine Verschlechterung Ihrer Verkaufsprognose Ihr Unternehmen profitabler macht. Das ist sehr inkonsistent. Operativ kann ich verstehen, warum die Leute das so machen, aber es ist ein viel fundierterer Ansatz, um diese anderen Unsicherheiten anzugehen und sie separat zu prognostizieren.
Conor Doherty: Ich möchte hier ein wenig Gegenwind einbringen, denn als ich damit zu werben begann, wiesen einige Leute darauf hin – und das sind Freunde des Kanals; das sind Leute, die wir interviewt haben – ein besonderer Gruß an Jonathan Karrel von Northland und Meinolf Sellmann von Inside Opt. Sie wiesen darauf hin, dass das, worüber wir heute sprechen – ich paraphrasiere hier – was Sie vorschlagen, nichts Neues ist. Die Idee, beispielsweise die Vorlaufzeit, Ausschussraten, Retouren usw. zu prognostizieren, ist seit Jahrzehnten Teil der Literatur und ist in der Tat in einigen Bereichen oder Branchen Standardprozedur. Wie reagieren Sie auf diesen Einwand?
Joannes Vermorel: Dass es in der Literatur zu finden ist – absolut, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Arbeiten aus der Ära der Operations Research in den 1950er Jahren finden können, die das diskutieren. Wie gesagt, das Verhältnis der Arbeiten ist tausend zu eins; es ist extrem oberflächlich. Das meiste, was man findet, sind nur beiläufige Hinweise.
Meine beiläufige Beobachtung, nachdem ich eineinhalb Jahrzehnte mit Hunderten von supply chain-Direktoren gesprochen habe, ist, dass diese Dinge bei 99% der Unternehmen fehlen. Wenn ich sagen würde, dass in der Praxis etwa 0% der Unternehmen dies tun, wäre das nur eine sehr bescheidene Schätzung. Von den einer Million Unternehmen weltweit, die irgendeine Art von supply chain haben, ja, wahrscheinlich gibt es Dutzende, die das tun; aber das ist im Vergleich verschwindend gering.
Conor Doherty: Das unterstreicht den Unterschied zwischen akademischem Bewusstsein und der Realität vor Ort. Aber um dem Vorteil des Zweifels zu geben, nehmen wir an, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen die von Ihnen beschriebenen Unsicherheitsquellen kennt. Warum würden sich Unternehmen dann vorwiegend auf die Nachfrage konzentrieren und die anderen Quellen größtenteils ignorieren oder unterbewerten?
Joannes Vermorel: In diesem Mainstream-Paradigma ist die Nachfrageprognose nicht wirklich eine Prognose, sondern ein Commitment. Das Unternehmen verpflichtet sich, diese Menge an Nachfrage zu bedienen. Hinter den Kulissen, zwischen den Abteilungen des Unternehmens, geht es um Territorien – Feudalherrschaften – darum, wer welchen Geldbetrag zur Unterstützung der eigenen Feudalherrschaft erhält. Das sind die Arten von Kämpfen, die im S&OP stattfinden: Marketing gegen Vertrieb gegen Betrieb usw. Jeder will ein größeres Stück vom Kuchen.
Hinter der Nachfrage steht der Gedanke, dass es sich nicht genau um eine statistische Prognose handelt; es ist auch ein Commitment und eine prophetische Aussage. Das Unternehmen sagt: “Wir projizieren das”, und mit einem selbstprophetischen Effekt weisen wir die richtige Menge an Ressourcen zu, um dies zu ermöglichen.
Betrachten Sie andere Unsicherheitsquellen, haben Sie das nicht. Bei der Prognose der Vorlaufzeit gibt es keinen territorialen Kampf um die Art der Prognose. Infolgedessen werden diese Dinge völlig beiseitegeschoben, während die Leute in das große Getümmel um die S&OP Master-Prognose hineinstürzen, die festlegt, wie viel Geld jede einzelne Abteilung, jede einzelne Produktlinie erhält.
Diese anderen Unsicherheitsquellen sind für die Entscheidung außerordentlich folgenschwer, aber sie sind nicht in derselben Weise für die inneren politischen Auseinandersetzungen im Unternehmen von Bedeutung. Deshalb glaube ich, dass sie im Allgemeinen völlig beiseitegeschoben werden. Es geht nicht darum, dass die Leute statistische Modelle zur Prognose der Nachfrage bevorzugen; tatsächlich ist die Nachfrageprognose der Kern der internen Kämpfe im Rahmen des S&OP zwischen den Abteilungen, die um die internen Ressourcen des Unternehmens konkurrieren.
Conor Doherty: Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, sprechen wir über das enorme Spektrum an Unsicherheiten. Doch immer, wenn Sie “andere Unsicherheiten” sagen, ist Ihr Standardbeispiel die Vorlaufzeiten. In jener Vorlesung, die ich zuvor erwähnt habe – Vorlesung 5.3; Alex, bitte posten Sie das im Live-Chat – sagten Sie, dass Vorlaufzeiten zu allen Unsicherheitsquellen zu den wichtigsten gehören, wenn nicht sogar die wichtigste sind, und dass sie “unglaublich unterbewertet” werden. Sie betonten “unglaublich”. Was macht Vorlaufzeiten so wichtig, und warum werden sie so unterbewertet?
Joannes Vermorel: Warum unterbewertet? Das haben wir gerade besprochen – kein Territoriums-Kampf – es ist wirklich eine Frage des reinen Risikomanagements. Das Ergebnis dieser Modellierung wird nicht bestimmen, wie viel Geld Marketing, Vertrieb oder Produktion letztendlich erhalten, dennoch hat es enorme Konsequenzen für die Rentabilität des Unternehmens.
Warum ist das so wichtig? Weil Lieferzeiten keine „schönen“ Verteilungen sind. Es ist nicht so, als hätte ich einen Lieferanten, der immer in 21 Tagen liefert. Bei Lokad haben wir mit Hunderten von Unternehmen und deren Datensätzen zu Lieferzeiten gearbeitet. Lieferzeiten sind sehr – ich würde sagen – fast immer bimodal. Man beobachtet einen deutlichen Gipfel, der die Lieferung darstellt, wenn alles in perfekter Abstimmung läuft und alles nach Plan verläuft. Das mag in manchen Branchen, wenn man sehr Glück hat, etwa 95 % der Zeit zutreffen; in anderen Branchen, wo es weniger zuverlässig ist, vielleicht 80 % der Zeit. Das ist der Moment, in dem die perfekte Ausrichtung gegeben ist und die Lieferung im vorgesehenen Zeitrahmen erfolgt.
Dann gibt es noch die Situation, in der die Planeten nicht ausgerichtet sind. Der typische Fall ist, dass Ihr Lieferant momentan einen Fehlbestand hat, sodass er nicht über die Ware verfügt und sie Ihnen nicht versenden kann. Es gibt Fälle, in denen der Transportunternehmer ein Problem hat, oder das Lager eines Zwischenhändlers voll ist, oder es bei der Zollabfertigung zu Verzögerungen durch eine verspätete Inspektion kommt. In dieser Situation – dem zweiten Modus – der je nach Branche zwischen 5 % und 20 % oder sogar 30 % der Fälle auftritt, verlängern sich die Verzögerungen extrem. Im schlimmsten Fall kommt die Ware buchstäblich nie an.
Wenn Sie sich Ihre durchschnittlich erwartete Lieferzeit anschauen – gemäß der mathematischen Definition – erhalten Sie sehr oft unendliche Werte, einfach weil manche Güter nie eintreffen. Bei der Durchschnittsberechnung fließt dann buchstäblich Unendlichkeit mit ein. Offensichtlich ist das ein wenig unsinnig, aber es soll verdeutlichen, dass diese Phänomene – der Fachbegriff lautet fat tails – bedeuten, dass wenn etwas nicht nach Plan läuft, es sehr lange schiefgehen kann. Genau das fangen beispielsweise Normalverteilungen nie ein. Sie berücksichtigen nicht, dass etwas, von dem man annimmt, dass es in drei Tagen eintrifft, stattdessen ein Jahr braucht – und dennoch passiert das häufig.
Conor Doherty: Das knüpft an etwas an – ich werde ein Zitat aus derselben Vorlesung noch einmal vorlesen. Im Zusammenhang mit Lieferzeiten sagten Sie, dass die Menschen diese typischerweise als „Variabilität“ behandeln, und Variabilität ist nicht etwas, das durch Compliance kontrolliert werden kann. Normalerweise wird sie nicht als Quelle der Unsicherheit betrachtet, in die technologisch eingegriffen werden muss; sie wird durch persönliche oder manuelle Intervention angegangen – so etwas wie: „Ich nehme das Telefon, ich rufe meinen Lieferanten an.“ Könnten Sie das näher erläutern?
Joannes Vermorel: Dies ist überwiegend die Mainstream-Sichtweise auf supply chains, bei der die zukünftige Nachfrage nicht exakt als Prognose mit Unsicherheit betrachtet wird, sondern als ein Commitment. Sobald Sie dieses Commitment haben, dreht sich alles um Compliance – Sie wollen nur minimale Abweichungen vom Plan. Jede Abweichung gilt als mangelhafte Compliance. Die Leute denken an Prozess-Exzellenz und dergleichen; deswegen wird diese Unsicherheit nicht wirklich angegangen, weil es ein Mindset gibt, in dem diese Variabilität einfach ein Mangel ist – etwas, das im nächsten Jahr, wenn wir den Prozess endlich verfeinert haben, verschwinden wird.
Warum sollten Sie etwas prognostizieren, das im nächsten Jahr weg sein wird, weil wir den Prozess endlich behoben haben? Leider ist das, was ich beschreibe – diese Unsicherheit – irreduzibel. Warum? Weil es nicht von Ihnen abhängt. Es sind Entscheidungen, die von anderen Menschen getroffen werden. Ihr Lieferant mag die Bestände haben, aber er könnte entscheiden, einen anderen Kunden vor Ihnen zu bedienen. Pech gehabt. Es ist zwar nicht der beste Lieferant, aber es ist der Lieferant, den Sie haben; es ist eine Entscheidung, die gegen Sie getroffen wurde.
Dasselbe gilt für die Preise Ihrer Mitbewerber. Es wäre so schön, wenn alle Ihre Mitbewerber ihre Preise erhöhen würden, sodass auch Sie Ihren Preis anheben könnten. Aber wissen Sie was? Irgendjemand wird den Preis senken. Wiederum liegt es nicht in Ihrer Hand.
Wenn wir Dinge wie Wetter, Tsunamis, Erdbeben – all die Naturereignisse, die stören – außer Acht lassen, dann sind diese Unsicherheitsquellen letztlich irreduzibel, weil sie auf Entscheidungen zurückzuführen sind, die noch nicht getroffen wurden und in Zukunft von anderen Menschen getroffen werden. Grundsätzlich versuchen Sie, Entscheidungen zu erraten, die in Zukunft von anderen Menschen getroffen werden. Genau das passiert, wenn Sie die Nachfrage prognostizieren: Sie prognostizieren buchstäblich die Entscheidung, dass diese Menschen Ihr Produkt in der Zukunft kaufen – sie können ihre Meinung ändern. Wenn Sie die Lieferzeit prognostizieren, gehen Sie davon aus, dass Ihr Lieferant das gleiche Investitionsniveau beibehält, damit er Sie rechtzeitig bedienen kann und seine Produkte nicht einstellt. All das ist Spekulation; deshalb benötigen Sie letztlich diese Vorhersagen.
Conor Doherty: Um Sie aus mehreren Quellen bezüglich der inhärenten Variabilität bestimmter Unsicherheitsklassen zu zitieren – Sie sagten, es liege nicht an Ihnen; zuvor argumentierten Sie, dass Variabilität nicht durch Compliance kontrolliert werden kann (also durch manuelle Intervention) – welche Möglichkeiten haben die Menschen tatsächlich, damit umzugehen? Eine Möglichkeit ist, es zu ignorieren; das haben wir bereits besprochen. Was gibt es sonst noch?
Joannes Vermorel: Sehr häufig werden die Menschen die Master-Prognose rückentwickeln. Wenn ich von Master-Prognose spreche, meine ich die Nachfrageprognose, denn in Unternehmen versteht man unter „forecasting“ – obwohl wir gesehen haben, dass Forecasting für alle Unsicherheitsquellen angewendet werden sollte: Nachfrage, Lieferzeit, Preise, Retouren, Qualitätsprobleme, Produktionsausbeute etc. – in der Praxis bezieht sich „forecasting“ meistens nur auf die Nachfrage.
Was sie tun, ist, die Nachfrageprognose rückzuentwickeln, indem sie diese nach oben oder unten anpassen, um das Commitment indirekt neu einzustellen, denn hinter der Master-Prognose stehen all die von der Firma eingegangenen Verpflichtungen – die Ressourcenallokation – und sie rekonstruieren die Master-Prognose, sodass diese Verpflichtungen im Hinblick auf die Risiken etwas mehr Sinn ergeben. Genau das geschieht in der Praxis. Da es ein sehr umständlicher Ansatz ist, ist er sehr ineffizient; es ist eine unglaublich indirekte Art, das Unternehmen zu steuern.
Conor Doherty: Ich achte auf die Zeit, daher mache ich weiter, aber ich möchte eine Frage stellen, die von einem Freund des Kanals kam, Jeff Baker – falls Sie bei MIT zuschauen, hallo. Er wies darauf hin, dass in vielen großen Unternehmen, insbesondere in der Fertigung, die heute verwendeten Ansätze üblich sind. Die Menschen sind sich dieser Vielzahl von Unsicherheiten bewusst; sie prognostizieren sie auch aktiv, aber er merkte an, dass es ihnen oft an Planungstools fehlt, um die Art von Informationen zu nutzen, die prognostiziert werden. Was halten Sie davon, und warum kann es sein, dass sehr große, sehr profitable Unternehmen, die sich der Unsicherheiten bewusst sind und diese aktiv, regelmäßig prognostizieren, sie dennoch nicht in den Entscheidungsprozess einbeziehen?
Joannes Vermorel: Zunächst einmal stelle ich in Frage, dass „sie diese prognostizieren“. Irgendwo haben sie ein data science Team, das Hunderte von Dingen prognostiziert, und niemand schenkt dem Beacht. Wir werden in der nächsten Episode auf Data Science eingehen. Das ist meine Meinung: Wenn die Leute sagen „Oh, ja, ja“, gibt es ein Data Science Team, das völlig isoliert arbeitet; es ist niemanden interessiert, was diese Leute tun. Ich würde sagen: irrelevant.
Nun, die Tatsache, dass Sie Planungstools besitzen – diese Planungstools spiegeln lediglich das wider, was man in der wissenschaftlichen Literatur findet, nämlich nichts. Die Planungstools reflektieren überwiegend das dominierende Paradigma, nämlich „die Absatzprognose ist König“, und das war’s. Wenn die Leute sagen „wir haben die Tools nicht“, dann, wenn man als Enterprise-Softwareanbieter Software verkauft, ist es wirklich kundengesteuert, besonders im Unternehmenssegment. Unternehmen werden ihre Anforderungen auflisten, und Anbieter werden sich einfach daran halten und liefern, was die Kunden verlangen. Wenn diese Fähigkeiten nicht vorhanden sind, liegt es in erster Linie daran, dass den Kundenunternehmen selbst das nicht wichtig war und nicht danach gefragt wurde.
Conor Doherty: Ich möchte weitermachen, denn es gibt einige private Fragen und einige öffentliche Kommentare. Letzte Frage, dann wenden wir uns dem Publikum zu. Wir haben heute viel besprochen. Welchen abschließenden Ratschlag geben Sie Unternehmen, die Ihrer Meinung zustimmen, aber möglicherweise nicht über die Planungstools oder die Software verfügen, um dies tatsächlich umzusetzen? Technologie und Einstellung – wie beurteilen Sie diese beiden Aspekte, um einen Unterschied zu machen?
Joannes Vermorel: Der erste Schritt besteht darin, eine grobe Faustformel zu verwenden, um in Euro und Dollar zu ermitteln, wie viel es kostet. Diese Dinge – da sie nie bewertet werden – werden von den Menschen als Betriebskosten hingenommen, und das war’s. Ist es für ein Unternehmen eine geringe Ausgabe oder etwas wirklich Großes? Das variiert. Meiner Ansicht nach handelt es sich bei den meisten groß skalierenden Unternehmen um eine Menge Geld.
Machen Sie die Faustformel-Rechnung, und dann würde ich vorschlagen: Gehen Sie zum C-Level, zu den Führungskräften, und versuchen Sie, eine Übereinkunft über das Ausmaß des Problems zu erzielen. Den Rest – die technischen Details – könnten wir besprechen, wie man es genau macht, usw. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass das Problem gar nicht anerkannt wird. Niemand hat jemals wirklich versucht, dem Ganzen einen monetären Wert beizumessen. Ja, einige haben das getan, aber nur sehr wenige. Dadurch entsteht kein Bewusstsein, und das Top-Management kann nicht feststellen, ob es sich um etwas wirklich Wichtiges oder lediglich um ein Spielerei handelt.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Top-Manager in einem sehr großen Unternehmen. Es klopfen so viele Leute an Ihre Tür und sagen: „Sie haben dieses Stück Technologie, das Sie nicht ignorieren können“, und täglich kommen zwanzig Menschen mit diesem Anliegen. Mein Vorschlag ist: Erstellen Sie einen ganz klaren Business Case – einfach. Ich spreche von Dingen, die nicht super fortschrittlich, nicht super technisch sind – einfach, um ein fundiertes Verständnis für das wahre Ausmaß des Problems zu erlangen. Präsentieren Sie das den zuständigen Entscheidern, und der Rest wird folgen. Menschen werden in großen Unternehmen nicht zu mächtigen Führungskräften, weil sie Idioten sind – das ist sehr selten. Große Unternehmen sind tatsächlich gut darin, diejenigen herauszufiltern, die sehr hoch in der Hierarchie aufsteigen; so überleben sie. Sobald ein Bewusstsein entsteht, wird alles seinen Lauf nehmen, gemäß dem im Unternehmen bevorzugten Modus Operandi.
Conor Doherty: Danke. Ich beachte die Zeit, da ich weiß, dass Sie einen straffen Terminplan haben, daher werde ich die öffentlichen Kommentare priorisieren, und die übrigen privat eingesendeten Fragen beantworten wir morgen auf LinkedIn.
Dies ist ein Kommentar und eine Frage von Murthy – ich hoffe, ich spreche das richtig aus. „Joannes, eine der zentralen Herausforderungen, denen CPG-Unternehmen und Einzelhändler gegenüberstehen, ist die Überlastung ihrer Distributions- und Fulfillment-Center aufgrund saisonaler Nachfrageänderungen. Könnten wir eine Sitzung organisieren, um Best Practices zur Vorhersage von Überlastungen und zur Entwicklung effektiver Entlastungsstrategien zu erörtern?“
Joannes Vermorel: Kurz gesagt: Absolut ja. Länger gesagt: Dies ist typischerweise ein Problem, das durch deterministische Punktschätzungen entsteht. Man projiziert die durchschnittliche Nachfrage – oder den durchschnittlichen Durchsatz, wenn wir von FMCG sprechen –, und dieser liegt gerade über oder etwas unter der Kapazität, woraufhin die Leute meinen, es sei in Ordnung.
Aber die Realität ist, dass – gerade bei FMCG/CPG – die Nachfrage sehr sprunghaft ist. Theoretisch liegt die wöchentliche Auslastung knapp unter 100 %, aber durch Schwankungen liegt man routinemäßig darüber. Ja, es gibt zahlreiche Techniken, um dem entgegenzuwirken. Wir sollten eine Technik namens „shadow valuations“ besprechen, bei der es darum geht, über die Zeit hinweg zu glätten, und dazu muss man ein Opportunitätskostenkonzept einführen, das das Risiko einer Sättigung Ihres DC, Ihrer Produktionseinheit, Ihres Transportunternehmens oder was auch immer tatsächlich der Engpass ist, widerspiegelt.
Das ist leicht anders als das Thema der verschiedenen Unsicherheitsquellen.
Conor Doherty: In diesem Zusammenhang, falls es bestimmte Sitzungen gibt, an denen die Leute interessiert sind, kommentieren Sie bitte unten oder kontaktieren Sie uns privat auf LinkedIn und schlagen Sie vor, falls Sie das nicht öffentlich tun möchten.
Wir könnten ebenso weitermachen. Entschuldigen Sie bitte, falls die Aussprache falsch ist. Kaizen – Verzeihen Sie. „In meinem Markt, der Luxusprodukte umfasst, ist die Nachfrage intermittierend und sehr gering. Was ist Ihr bester Ratschlag zur Steigerung der Genauigkeit? Hinweis: Wir prognostizieren bereits auf aggregierter Ebene.“
Joannes Vermorel: Wir haben nur wenige Minuten, daher ist es unsinnig zu behaupten, Zeitreihen würden passen. Fakt ist, dass Zeitreihen fehlerhaft sind – sie sind einfach kaputt. Was die Leute tun, wenn sie auf eine Situation stoßen, die nicht zu Zeitreihen passt, ist, dass sie versuchen, das Problem so umzugestalten, dass es zu Zeitreihen passt. Hier sprechen wir davon: „Lassen Sie uns alles nach Quartal, nach Region aggregieren“, und dann hat man wieder umfangreiche Zeitreihen, die Substanz haben und prognostizierbar sind.
Kurz gesagt: Sie müssen auf Zeitreihen verzichten. Sie sind völlig ungeeignet für den Luxusbereich. Wir haben Luxus-Kunden; Zeitreihen sind dafür schlicht nicht geeignet. Das mag für zum Beispiel Unilever funktionieren, aber nicht für spärliche, intermittierende Nachfrage. Es wird nicht für den Einzelhandel funktionieren; es wird nicht für aviation funktionieren; es wird nicht für Öl und Gas funktionieren; es wird generell nicht für Luxus und Mode funktionieren.
Das ist die kurze Antwort: Verzichten Sie auf Zeitreihen. Es gibt alternative Ansätze, aber—
Conor Doherty: Ich wollte uns nicht billig anpreisen; ich wollte sagen, dass wir tatsächlich weitere Ressourcen dazu haben. Alexey, falls du das hörst, bitte teile einige der Lernressourcen zur Prognose für Luxusmärkte im Chat. Sehr hilfreich.
Wir haben Zeit für einen letzten Kommentar, der sich ebenfalls auf Luxusprodukte bezieht: „Wir prognostizieren die Nachfrage bereits als Verteilungen. Was ist der schnellste, am wenigsten störende Weg, um Lieferzeit-Verteilungen in unsere Einkaufslogik einzubinden?“ Ich verstehe, dass das eine sehr große Frage ist.
Joannes Vermorel: Es kommt wirklich auf Ihre Einrichtung an – darauf, wo Ihr aktuelles numerisches Rezept sitzt, der Algorithmus beziehungsweise die Entscheidungsfindungs-Engine. Das können Sie mit Excel lösen; wir haben sogar eine Excel-Tabelle, in der wir zeigen, dass man selbst in Excel mit probabilistischen Einstellungen umgehen kann. Es ist etwas unansehnlich, aber wenn Sie geduldig sind, ist es machbar.
Wenn Sie wirklich in Eile sind, müssen Sie Heuristiken – willkürliche numerische Berechnungen – finden, die in etwa das tun, was Sie möchten. Ich würde sagen: Finden Sie einfach eine Heuristik, die besser ist als das Rückentwickeln der Nachfrage selbst. Es ist zwar immer noch provisorisch – quasi wie Klebeband –, aber ein Schritt besser als das Herumfummeln an der Nachfrage. Dann können Sie sich ansehen, wie wir probabilistische Prognosen in Excel umsetzen, falls Ihnen nichts anderes zur Verfügung steht.
Wenn wir weitergehen wollen, schaffen es Spezialisten wie Lokad, diese Dinge in nur wenigen Monaten umzusetzen. Es ist kein großes Projekt, aber das bedeutet, die gesamte Pipeline umzustellen, sodass wir ein tatsächliches, richtiges numerisches Rezept haben. Irgendwann können Sie der Tatsache nicht mehr entkommen, dass Sie ein programmatisches numerisches Rezept für Ihre supply chain einführen müssen – aber das ist ein anderes Thema.
Conor Doherty: Mir wurde gesagt, euch in vierzig Minuten rauszubringen, also haben wir Zeit für einen sehr knappen abschließenden Gedanken. Basierend auf allem, was wir besprochen haben – nur dreißig Sekunden – was ist dein Pitch an die Leute, wenn es darum geht, über die Nachfrageprognose hinaus zu blicken?
Joannes Vermorel: Betrachte es als Risikomanagement. Entscheidungsfindung in supply chain ist Risikomanagement. Wenn du nur die Nachfrage prognostizierst, behauptest du, das einzige Risiko bestehe darin, ob Kunden erscheinen oder nicht, und du ignorierst alle anderen Risiken. Es ist nicht gut; es ist kein richtiges Risikomanagement.
Mein abschließender Gedanke wäre: Schätze ein, wie viel Geld durch die Vernachlässigung dieser anderen Risiken auf dem Tisch liegen bleibt. Schau dir an, wie viel dein Unternehmen verschwendet, und bring das deinem Chef vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute reagieren und nach Lösungen suchen werden, sobald sie das Ausmaß des Problems erkennen.
Conor Doherty: Danke. Wir haben keine Fragen mehr, und die Zeit ist ebenfalls um. Wie immer, danke, dass ihr dabei wart – und auch an alle anderen: Danke fürs Kommen und für eure Fragen. Wie bereits erwähnt, verbindet euch gerne mit Joannes und mir auf LinkedIn, wenn ihr diese Themen privat besprechen möchtet. Wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Episode von Supply Chain Breakdown.
Und in diesem Sinne, an euch alle: Zurück an die Arbeit.