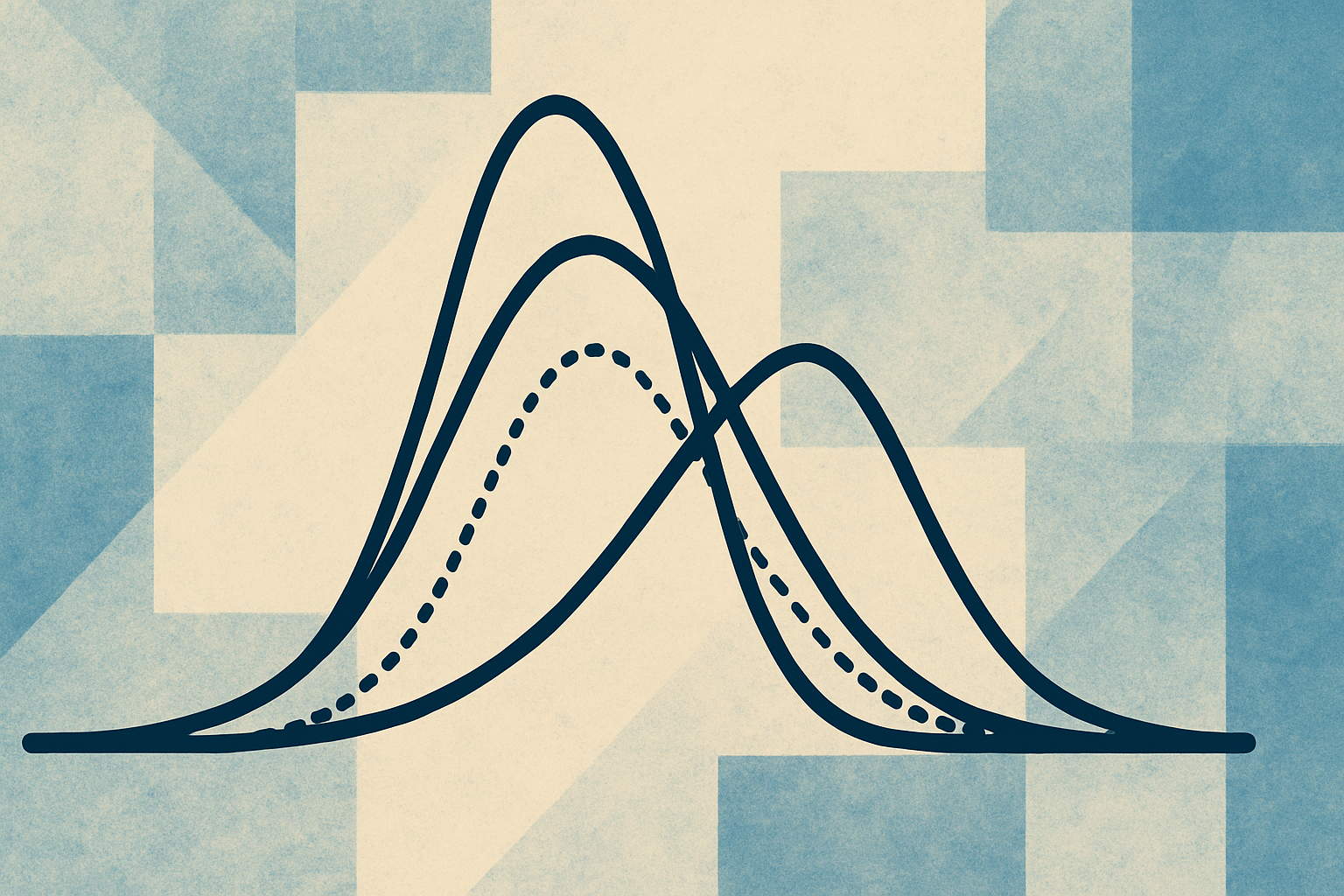Eine Reflexion über David Simchi-Levi’s Arbeit
Unter supply chain-Experten werde ich oft gefragt, wie meine Ansichten zu denen von David Simchi-Levi im Verhältnis stehen, dessen Lehrbücher und Forschung einen großen Teil des modernen Vokabulars des Fachgebiets geprägt haben. Es ist eine naheliegende Frage: Viele Praktiker haben supply chain schon anhand seiner Modelle und Fallstudien kennengelernt, lange bevor sie auf meine eigene Arbeit gestoßen sind. Unsere Schlussfolgerungen reimen sich häufig, aber die Wege, die wir einschlagen, um sie zu erreichen, unterscheiden sich in wesentlichen Punkten, und diese Unterschiede – in der Art, wie wir die Disziplin, die Zukunft und die Rolle der Software rahmen – haben praktische Konsequenzen dafür, wie Unternehmen ihre supply chains entwerfen und betreiben.

Ich habe meine Ansichten ausführlicher an anderer Stelle dargelegt, zuletzt in meinem Buch Einführung in die supply chain und im Essay Supply Chain as Economic Bets in a Market-Driven World, doch mein Anliegen hier ist bescheiden: meine eigene Perspektive zu klären, indem ich sie nebeneinander zu der von Simchi-Levi stelle. Ich werde mich dabei auf sein vielgelesenes Lehrbuch Designing and Managing the supply chain sowie sein Management-Buch Operations Rules konzentrieren und auf seine Arbeiten zu supply chain-Risiken und Digitalisierung eingehen.
Was verwalten wir eigentlich?
Wenn man in einem typischen Operations-Lehrbuch fragt, was supply chain management ist, wird man vermutlich eine Variante der folgenden Definition finden: die Integration von Lieferanten, Fabriken, Lagern und Geschäften, sodass das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort geliefert wird – bei minimalen Gesamtkosten und unter Einhaltung der Serviceanforderungen. Simchi‑Levis Lehrbuch bleibt diesem Geist treu und leistet gute Arbeit bei der Entwicklung entsprechender Modelle.
Diese Definition ist nicht falsch; sie ist einfach unvollständig. Sie beschreibt die Infrastruktur, aber nicht das eigentliche Spiel.
Für mich ist supply chain in erster Linie eine wirtschaftliche Aktivität. Unternehmen sind nicht im Geschäft, „Logistikkosten zu minimieren“ oder „Servicelevels zu maximieren“ im Abstrakten. Sie befassen sich damit, knappe Ressourcen – Geld, Kapazitäten, Regalfläche, ja sogar die Aufmerksamkeit der Planer – umzuschichten, in der Hoffnung, schneller mehr Geld zurückzubekommen. In diesem Sinne ist supply chain angewandte Ökonomie unter Unsicherheit, realisiert durch Software. Diese Sichtweise entwickle ich systematisch – indem ich supply chain als ein Portfolio ökonomischer Wetten unter Unsicherheit beschreibe – in Supply Chain as Economic Bets in a Market-Driven World.
Sobald man supply chain so betrachtet, ist das zentrale Element nicht der LKW oder das Lager, sondern die Option: die Fähigkeit, etwas Wertvolles zu tun, wenn sich die Umstände in die eine oder andere Richtung entwickeln. Inventar stellt eine Option zum Verkauf dar. Überschüssige Produktionskapazitäten sind eine Option, um auf einen Nachfrageschub zu reagieren. Ein zweiter Lieferant ist eine Option, um einer Geiselfang-Situation zu entgehen. Der Sinn der Disziplin besteht darin, diese Optionen zu kultivieren und auszuschöpfen, um überlegene Erträge zu erzielen.
Simchi‑Levi erkennt die Unsicherheit selbstverständlich an und hat umfangreich über Risikopooling, die Abschwächung von Bullwhip-Effekten sowie das Design flexibler Netzwerke geschrieben. Wo wir uns unterscheiden, ist, dass für ihn Unsicherheit etwas ist, das kontrolliert werden muss; für mich ist sie die eigentliche Substanz, aus der supply chain Wert schöpft.
Zielfunktionen: Geld versus Stellvertreter
Ein zweiter Bereich, in dem unsere Perspektiven auseinandergehen, betrifft die Frage, was wir zu optimieren versuchen.
Im Designing and Managing the supply chain lautet die Standardformulierung, die Gesamtsystemkosten – Produktion, Transport, Inventar, Anlagen – bei Einhaltung der Service- und Kapazitätsgrenzen zu minimieren. Dies ist die Sprache, in der viele Optimierungsmodelle in der Operations Research formuliert wurden: hier eine gewichtete Summe der Kosten, dort eine Servicelevel-Beschränkung.
Im Operations Rules macht Simchi‑Levi einen wichtigen Schritt nach vorn. Er besteht darauf, dass die Operations-Strategie in der Wertschöpfung des Unternehmens verankert sein muss und argumentiert, dass Flexibilität der Schlüssel ist, der Operations mit dem Kundenwert verbindet. Dies ist eine kraftvolle Botschaft, und ich stimme der Idee, dass Flexibilität unverhältnismäßig wertvoll ist, voll und ganz zu.
Problematisch finde ich, wenn die Zielfunktion auf der Ebene von „Kosten und Servicelevels“ oder „Kundenwert“ belassen wird, ohne alles durch das enge Raster von Geld und Zeit zu schleusen. Wenn wir unsere vielen Kennzahlen nicht auf etwas wie eine Rendite auf das eingesetzte Kapital und Risiko reduzieren, optimieren wir effektiv Stellvertreter. Stellvertreter sind zwar praktisch, stellen aber auch subtile Quellen von Fehlanpassungen dar. Es ist durchaus möglich, Servicelevels zu verbessern und lokale Kosten zu senken, während gleichzeitig der Wert für die Aktionäre zerstört wird, sobald Kapitalintensität, Risiko und Opportunitätskosten angemessen berücksichtigt werden.
Dies ist kein Aufruf, einen einzigen magischen KPI anzubeten. Es ist ein Appell, anzuerkennen, dass supply chain-Entscheidungen letztlich Investitionsentscheidungen sind. Sie sollten als solche formuliert und bewertet werden.
Die Zukunft planen versus sich auf sie vorbereiten
Ein dritter Unterschied betrifft unsere Haltung gegenüber der Zukunft an sich.
Simchi‑Levis Gesamtwerk geht – ganz berechtigterweise – davon aus, dass Unternehmen planen. Prognosen werden verfeinert, Push- und Pull-Prozesse getrennt, Inventarziele festgelegt und Kapazitäten zugewiesen. Bessere Modelle, Risikopooling und Verträge machen diese Pläne robuster. Das zugrunde liegende Weltbild ist, dass es einen „guten“ Plan für das Netzwerk gibt und dass es unsere Aufgabe ist, diesen trotz der Unsicherheit anzunähern.
Meine Erfahrung in der Industrie hat mich gegenüber dieser Planungsmentalität misstrauisch gemacht. Nicht, weil Planung nutzlos wäre, sondern weil die Art und Weise, wie sie praktiziert wird, dazu neigt, Vorhersage mit Kontrolle zu verwechseln. Prognosen werden als eine Art fragile Wahrheit über die Zukunft behandelt. Sobald sie vereinbart sind, werden sie zu einem Zwang, dem sich alle fügen müssen. Abweichungen werden als Ausführungsfehler gesehen, statt als Signale der Realität.
Meiner Ansicht nach ist die Zukunft keine technische Spezifikation, die wir erreichen können, wenn wir nur hart genug an unseren Planungstabellen arbeiten. Sie ist ein umkämpftes, pfadabhängiges und zutiefst unsicheres Umfeld, geprägt von Wettbewerbern, Regulierungsbehörden, Kunden und zufälligen Ereignissen. Vor diesem Hintergrund stellt sich nicht die Frage „Was ist der richtige Plan?“, sondern „Welches Portfolio an Optionen benötigen wir, damit uns, wenn die Zukunft uns überrascht, eher geholfen als geschadet wird?“
Simchi‑Levis Arbeiten zur Risikobelastung drehen sich genau um dieses Portfolio, auch wenn er dabei eine andere Sprache verwendet. Sein Risk Exposure Index, der auf den Begriffen „Zeit zur Erholung“ und „Zeit zum Überleben“ basiert, bietet eine quantitative Methode, um zu identifizieren, welche Anlagen oder Lieferanten das größte Störungsrisiko darstellen, und um Gegenmaßnahmen zu priorisieren. Das befürworte ich. Meine Kritik richtet sich nicht gegen das Instrument, sondern gegen den Restglauben, dass wir, sobald wir unser Netzwerk angepasst und Stresstests durchgeführt haben, wieder „auf dem richtigen Weg“ zu einem Plan seien.
Von meiner Seite aus plädiere ich für eine Entscheidungsfindung, die weniger darauf abzielt, sich auf eine einzige Prognose zu einigen, als vielmehr darauf, Optionen kontinuierlich zu bewerten und neu zu bewerten, sobald neue Informationen eintreffen. In der Praxis bedeutet dies, probabilistische Ansichten von Nachfrage und Angebot zu übernehmen und sie direkt in die Logik der Entscheidungen einzuspeisen, anstatt sie als separate Prognoseaktivität zu behandeln, die die Planungstreffen unterstützt. Diese Kritik an einzahligen Prognosen und Konsensplanung habe ich erstmals im Abschnitt „Forecasts, plans, and the illusion of certainty“ in Supply Chain as Economic Bets in a Market-Driven World dargelegt.
Die Rolle der Software: von Aufzeichnungen zu Entscheidungen
Hier liegt der Kontrast weniger zwischen Simchi‑Levi und mir, sondern vielmehr zwischen zwei Epochen.
Simchi‑Levi schreibt in der Tradition der Operations Research. Seine Bücher präsentieren Modelle – für Netzdesign, Inventar, Verträge, Flexibilität – und Fallstudien, die zeigen, wie Unternehmen diese Modelle zur Leistungsverbesserung nutzen können. Informationstechnologie erscheint als Ermöglicher: ein Weg, um eine bessere Planung umzusetzen, bessere Daten zu sammeln und, in jüngerer Zeit, Analytik und Machine Learning im großen Maßstab anzuwenden. Seine neueren Arbeiten kombinieren explizit Digitalisierung, Analytik und Automatisierung als die drei Säulen einer modernen supply chain.
Ich teile diese Begeisterung für Daten und Analysen, lege jedoch viel mehr Wert auf die Softwarearchitektur selbst. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die meisten Großunternehmen einen Stapel von „Systems of Records“ – ERP, WMS, TMS und ähnliche – aufgebaut, um Transaktionen zu erfassen. Darüber hinaus haben sie Reporting- und Planungstools entwickelt oder erworben, die die Vergangenheit aufschlüsseln und menschliche Entscheidungen koordinieren. Was bisher größtenteils noch fehlt, ist eine dedizierte Schicht, deren alleiniger Zweck es ist, Entscheidungen automatisch, in großem Maßstab und unter Unsicherheit zu treffen und auszuführen.
Diese Entscheidungssysteme sind nicht nur „clevere Reports“. Sie kodieren tatsächliche ökonomische Logik: Was ein akzeptabler Kompromiss zwischen dem Risiko eines Bestandsmangels und den Opportunitätskosten des Kapitals ist; wann es rational ist, für eine zweite Quelle zu zahlen; wie knappe Kapazitäten neu zugewiesen werden sollen, wenn die Nachfrage in einer Region stark ansteigt und in einer anderen zusammenbricht. Sie laufen täglich oder stündlich mit minimaler menschlicher Intervention. Ihre Leistung bemisst sich nicht an den projizierten Einsparungen in einem Business Case, sondern an den realisierten Cashflows.
Nichts in Simchi‑Levis Schreibweise widerspricht dieser Vision. Im Gegenteil, seine Beharrlichkeit, dass Unternehmen Analytik und Machine Learning nutzen sollten, um bessere Preise, Werbeaktionen und Abläufe zu erzielen, steht voll und ganz im Einklang damit. Wo ich deutlich nachdrückere, ist, dass Unternehmen, sofern sie die Entwicklung dieser Entscheidungssysteme nicht als ein erstklassiges Softwareproblem behandeln, niemals vollständig von den Modellen und Erkenntnissen profitieren werden, die Akademiker wie er seit Jahrzehnten produzieren.
Anreize und das menschliche System rund um die Modelle
Modelle und Software existieren nicht im luftleeren Raum. Sie sind in Organisationen eingebettet, die von Menschen mit Anreizen, Ängsten und Karriereplänen bevölkert sind. Auch hier liegt mein Fokus etwas anders als bei Simchi‑Levi.
Seine Lehrbücher erkennen Zielkonflikte zwischen Einkauf, Produktion, Logistik und Vertrieb an, und er erörtert vertragliche Mechanismen und Koordinationsmodelle, um supply chain-Partner in Einklang zu bringen. Dies ist ein wichtiges Thema, und seine Arbeiten zu Verträgen, Flexibilität und Risikoteilung werden häufig zitiert.
Meine Erfahrungen mit großen Implementierungen haben mich pessimistischer gemacht, was die Frage angeht, wie leicht diese Fehlanpassungen allein durch guten Willen und ausgeklügelte Verträge behoben werden können. Einige Interessenkonflikte sind strukturell bedingt. Ein Softwareanbieter, der pro Nutzer bezahlt wird, hat wenig Anreiz, die Arbeit der Planer zu automatisieren. Ein Berater, der tageweise abrechnet, wird kaum die einfachste Lösung empfehlen, die seine Anwesenheit überflüssig machen würde. Eine Funktion, deren Prestige von der Mitarbeiterzahl abhängt, wird instinktiv Automatisierung widerstehen.
Das sind keine moralischen Fehlleistungen; sie sind lediglich vorhersehbare Verhaltensweisen unter bestimmten Anreizstrukturen. Für supply chain-Führungskräfte bedeutet dies, dass die Architektur des Entscheidungssystems auch die Gestaltung des menschlichen Systems darum herum einschließt: Wer verantwortet welche Entscheidungen, wer wird für was belohnt, wer hat die Autorität, von manuellen zu automatisierten Modi zu wechseln. Ohne dies werden selbst die besten Analyseframeworks zu etwas politisch Akzeptablem, aber wirtschaftlich Mittelmäßigem gezügelt.
Konvergenzen, die es zu bewahren gilt
Bisher habe ich Unterschiede betont, weil sie meine eigene Position verdeutlichen. Es ist ebenso wichtig anzuerkennen, wo Simchi‑Levi und ich übereinstimmen, denn diese Konvergenzen verraten etwas über die Richtung, in die sich das Fachgebiet bewegt – nahezu unabhängig vom philosophischen Ausgangspunkt.
Wir behandeln supply chains beide als Systeme und lehnen lokale, isolierte Optimierungen ab. Wir betrachten Unsicherheit und Variabilität als zentral, nicht als nebensächliche Störfaktoren. Wir sind uns einig, dass Flexibilität – egal ob man sie Flexibilität oder Optionalität nennt – unverhältnismäßig wertvoll ist und dass Unternehmen bereit sein sollten, dafür zu zahlen. Außerdem sehen wir Daten, Analytik und Automatisierung als wesentlich für jeden ernsthaften Verbesserungsversuch.
Diese geteilten Überzeugungen sind alles andere als trivial. Vor zwanzig Jahren drehte sich in vielen Vorstandsetagen die dominante Erzählung noch um Lean, Just-in-Time und Single-Sourcing – Effizienz als Selbstzweck. Heute, nach Lockdowns, Kriegen und Finanzkrisen, verschiebt sich die Diskussion allmählich hin zu Resilienz, Optionalität und digitalen Fähigkeiten. Simchi‑Levis Arbeiten zur Risikobelastung haben diesen Wandel in Vorstandsetagen und sogar in politischen Kreisen vorangetrieben. Ich betrachte meine eigene Arbeit als Teil derselben Bewegung, wenn auch mit anderem Schwerpunkt und Vokabular.
Warum die philosophischen Details eine Rolle spielen
Man könnte sich fragen: Wenn sich die Empfehlungen oft ähneln – mehr Flexibilität, bessere Analytik, ganzheitlicheres Design – warum dann mit philosophischen Streitfragen über Ziele und die Natur der Zukunft aufwändige Diskussionen führen?
Denn in der Praxis schleichen diese philosophischen Details in Gestaltungsentscheidungen ein.
Wenn man in Begriffen von „Kostenminimierung für ein gegebenes Servicelevel“ denkt, wird man versucht sein, Serviceziele als exogen zu behandeln und in starre Einschränkungen zu bannen. Denkt man hingegen in Begriffen der „Maximierung des ökonomischen Ertrags unter Unsicherheit“, hinterfragt man eher, ob die Serviceziele wirtschaftlich gerechtfertigt sind, und passt sie dynamisch an die sich ändernden Bedingungen an.
Wenn Sie die Zukunft als etwas betrachten, das sich durch einen einzigen Plan annähern lässt, werden Sie stark in Planungszyklen, Meetings und Konsensbildung investieren. Wenn Sie die Zukunft jedoch als eine Quelle von Überraschungen ansehen, die es auszunutzen gilt, werden Sie mehr in Datenpipelines, automatisierte Entscheidungsprozesse und Optionen investieren, die Ihnen Handlungsspielraum verschaffen, wenn Pläne unweigerlich scheitern.
Wenn Sie IT hauptsächlich als Unterstützungsfunktion zur Umsetzung besserer Planung betrachten, werden Sie ein weiteres Modul für Ihr ERP kaufen. Wenn Sie sie hingegen als das Medium sehen, in dem Ihre ökonomische Logik lebt, werden Sie sich um die Trennung zwischen Systems of Record und Systems of Decision, um die Versionierung von Modellen, um Experimentierung und um sichere Rückabwicklung kümmern.
Simchi‑Levi’s Arbeit stößt Unternehmen in vielen dieser Bereiche in die richtige Richtung. Mein eigener Beitrag besteht darin zu argumentieren, dass wir noch weiter gehen müssen: supply chain als eine ökonomische Entscheidungs‑Engineering-Disziplin zu behandeln, deren natürlicher Platz die Software ist; unseren Erfolg letztlich in Geld und Zeit zu messen; und Organisationen sowie Systeme aufzubauen, die Unsicherheit nicht als einen zu unterdrückenden Feind, sondern als den Rohstoff des Profits behandeln.
In diesen Punkten ist der Gegensatz nicht persönlich. Es ist eine Entscheidung, die jeder supply chain leader treffen muss.