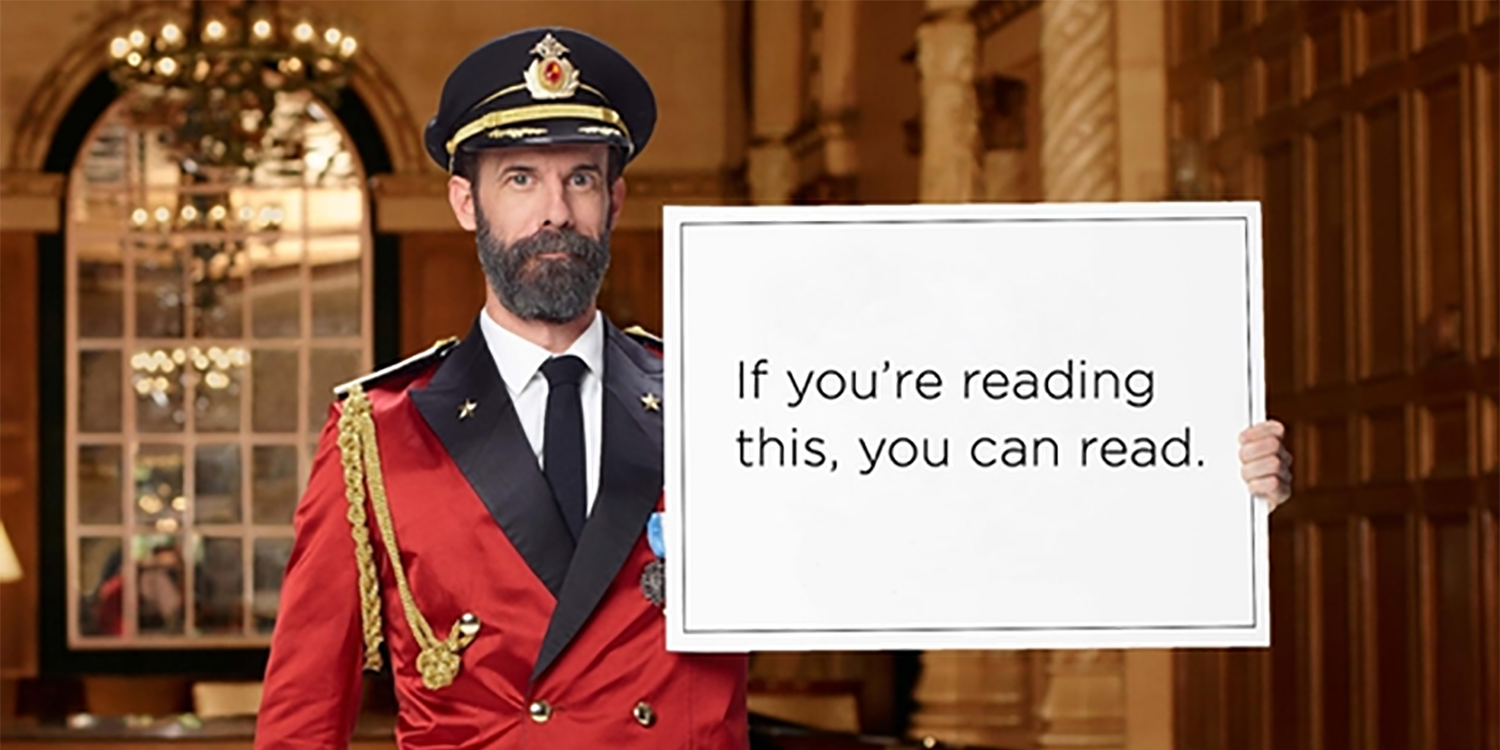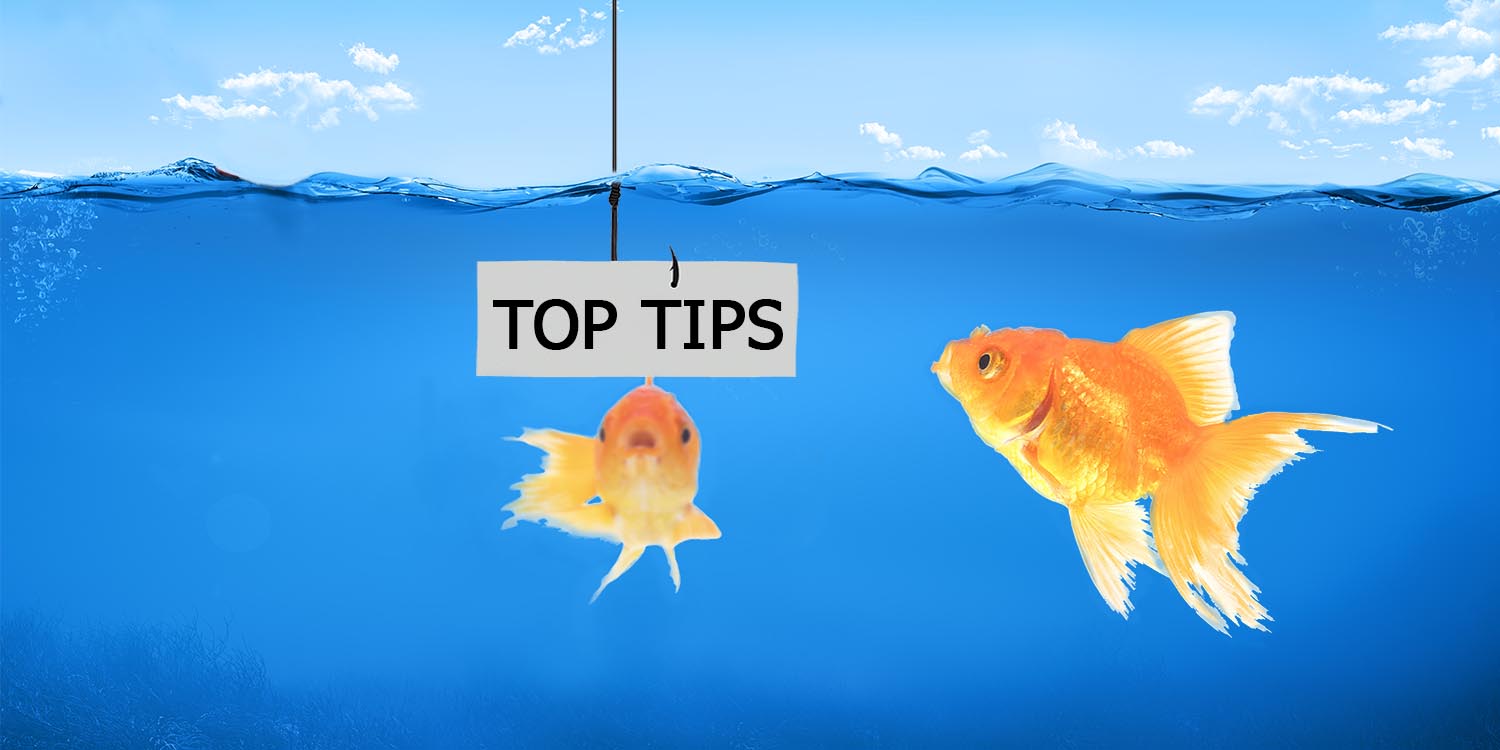supply chain Geschichte: Der Bullwhip Job
Meine erste professionelle supply chain-Erfahrung fand bereits im Jahr 2004 statt. Zu der Zeit war ich Student der Informatik an der École Normale Supérieure (ENS), einer Universität in Paris. Meine Interessen umfassten ein breites Spektrum rein theoretischer Fächer, doch faszinierte mich auch die Idee, diese Theorien in der Praxis zu testen. Der ideale Plan, dachte ich, wäre es, für ein solches Unterfangen bezahlt zu werden. Allerdings war ich nicht besonders am Geld interessiert. Die Studierenden an der ENS erhielten bereits ein Gehalt vom Staat – es ist eine sehr französische Sache – aber mir schien, dass ein Sponsor sicherstellen würde, dass ich meine Zeit nicht völlig vergeudete.
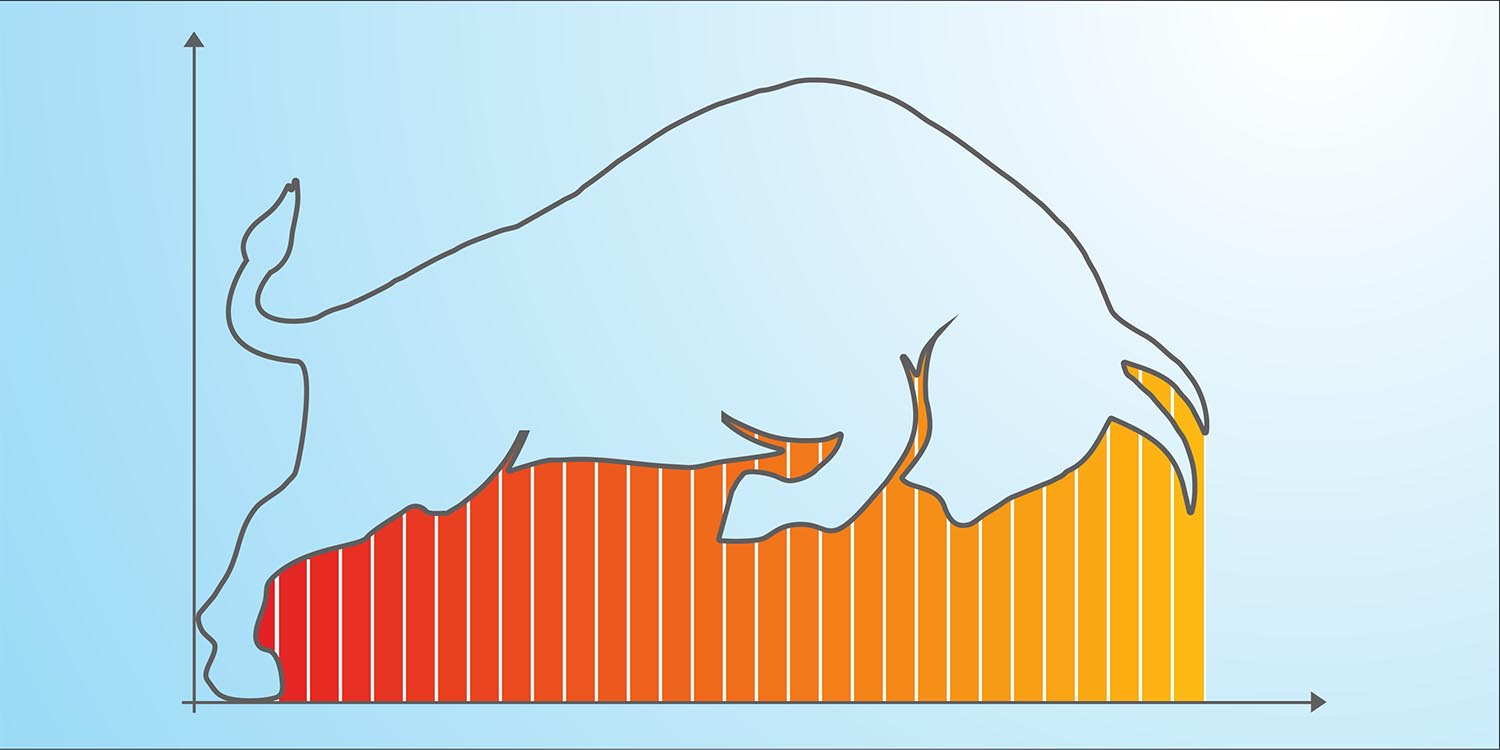
Der nächste Schritt bestand also darin, einen solchen Sponsor zu finden. Ich begann, mich umzuhören. Es stellte sich als eine eigenartige Erfahrung heraus. Tatsächlich besteht der Zweck der ENS darin, Beamte auszubilden, die ihr Leben dem Dienst am Staat widmen werden. Meine Karriere verlief in dieser Hinsicht nicht gerade wie geplant. Deshalb wurden Anfragen bezüglich Kontakte zum Privatsektor (gelinde ausgedrückt) missbilligt. Dennoch entdeckte ich schließlich, dass die ENS ein „geheimes“ Juniorunternehmen namens The Institute of the ENS besaß. Der Name ließ auf nichts schließen, was, so denke ich, genau der Sinn der Sache war. Juniorunternehmen sind gemeinnützige Organisationen, die Studierenden kurzzeitige, angestelltartige Tätigkeiten bieten.
Der erste Sekretär des Instituts, ein angenehmer Mann mittleren Alters, empfing mich. Er teilte mir mit, dass das Institut nicht gerade florierte. Ich sei der erste Student seit Monaten gewesen, und er habe keinen Arbeitsplatz, den er mir anbieten könnte. Das war enttäuschend, also machte ich weiter.
Der Ehrenpräsident des Instituts stellte sich als der tatsächliche Präsident eines über 10-Milliarden-Euro schweren Lebensmittel-Einzelhandelsnetzes heraus. Einige Tage später, nachdem er meinen Fall geprüft hatte, bot er mir einen Auftrag als externer Mitarbeiter in seinem eigenen Unternehmen an. Einzelheiten, wie die tatsächliche Art der Tätigkeit, sollten später und von anderen geklärt werden. Ich stimmte zu und wurde sofort in die guten Hände seines supply chain-Direktors gegeben.
Der supply chain-Direktor war ein vielbeschäftigter Mann. In seinen Sechzigern hatte er sich scharf und fit erhalten. Eine massive Initiative, vorangetrieben von einer renommierten Beratung, war in Gange. Der Codename der Initiative lautete „Bullwhip“ in Anspielung auf ein scheinbar sehr einflussreiches Papier mit dem Titel „The Bullwhip Effect“, das einige Jahre zuvor veröffentlicht worden war. Französische Teams waren sogar in die USA geflogen, um spezielle Coaching-Sitzungen zu diesem Thema zu erhalten. Natürlich wusste ich nichts über dieses Papier. Der Direktor brachte mich hastig auf den neuesten Stand und zeigte mir einige Durchflussdaten aus dem Einzelhandelsnetz.
Obwohl ich kaum etwas über supply chain wusste, stellte sich heraus, dass ich ein Interesse an der menschlichen Wahrnehmung von Zufälligkeit hatte. Eines der verwirrendsten wissenschaftlichen Ergebnisse dieses Forschungsbereichs ist, dass Menschen im Durchschnitt sehr schlecht darin sind, „statistisches Rauschen“ zu erkennen. Wir Menschen haben eine enorme Neigung, überall Muster zu sehen.
So war ich, obwohl die Fluktuationen im Durchfluss tatsächlich sehr ausgeprägt waren, sofort skeptisch gegenüber ihren Ursachen. Ich teilte meine Skepsis mit dem Direktor. Diese Schwankungen könnten, so sagte ich, allein durch die Zufälligkeit der Nachfrage erklärt werden. Ich war nicht überzeugt, dass einer der vier Faktoren, wie sie in dem ursprünglichen Bullwhip-Papier aufgeführt wurden, wesentlich mit den Problemen des Einzelhandelsnetzes zu tun hatte.
Der Direktor war zwar nicht überzeugt, sah jedoch eine Gelegenheit, mich beschäftigt zu halten – und vor allem, mich aus seinem ansonsten vollen Terminplan herauszuhalten. Er fragte mich, ob ich programmieren könne. Ich sagte, ja. Also begann er, den Schlachtplan für einen Simulator darzulegen, den ich implementieren sollte, um diese Zufallshypothese zu testen. Es wurden kaum Daten benötigt, etwa ein Dutzend Makroparameter, die das Netzwerk und sein Sortiment charakterisierten. Das gesamte Treffen hatte weniger als eine Stunde gedauert, und ich wurde entlassen.
Einige Wochen später hatte ich den Simulator implementiert, und siehe da, er zeigte Fluss-Schwankungen, die denen in der Praxis ähnelten. Die Ursache waren banale Fehlbestände bei verderblichen Produkten. Fehlbestände erzeugten einen kleinen, aber konstanten Synchronisationsdruck auf alle Flüsse, sowohl von den Lieferanten zu den Lagerhäusern als auch von den Lagerhäusern zu den Geschäften. Da es keinem aktiven Gegenwirkungsdruck mangelte, entwickelten sich aus kleinen zufälligen Wellen letztlich große, aber immer noch zufällige Wellen in den Flüssen. Ein weiteres Treffen wurde organisiert.
Er überprüfte meine Ergebnisse sorgfältig. Er hinterfragte eine Reihe von Implementierungsdetails. Meine Antworten erschienen zufriedenstellend. Er beauftragte mich, einige Gegenexperimente mit alternativen Annahmen durchzuführen. Einige Tage später kam ich mit weiteren Ergebnissen zurück. Das Gesamtergebnis blieb unverändert. Die Gegenexperimente entsprachen genau dem, was wir beide erwartet hatten. Ich wusste es noch nicht, aber dies sollte das letzte Treffen mit ihm für Jahre bleiben.
Am nächsten Tag wurden die Berater, mich eingeschlossen, entlassen. Das neue Motto lautete: Zurück zu den Grundlagen.
Diese massive Initiative war auf der inzwischen widerlegten Annahme gestartet worden, dass durch die Behebung der Ursachen des Bullwhip-Effekts die negativen Konsequenzen aufhören oder zumindest weitgehend abgemildert würden. Diese erwarteten Vorteile waren einfach verschwunden. Das obere Management war wütend. Aus ihrer Perspektive waren sie hereingelegt worden. Um dem Ganzen noch Salz in die Wunde zu streuen: Es hatte nur den zufälligen Beitrag eines Studenten gebraucht, um das Ganze zu entlarven. Die Gegenreaktion kam schnell und heftig.
Aus dieser Erfahrung, meinem ersten Job, nahm ich meinen ersten Beratungsgehaltsscheck mit und die Überzeugung, dass das Primum non nocere (zuerst nicht schaden) nicht nur als medizinisches Prinzip gedacht war.