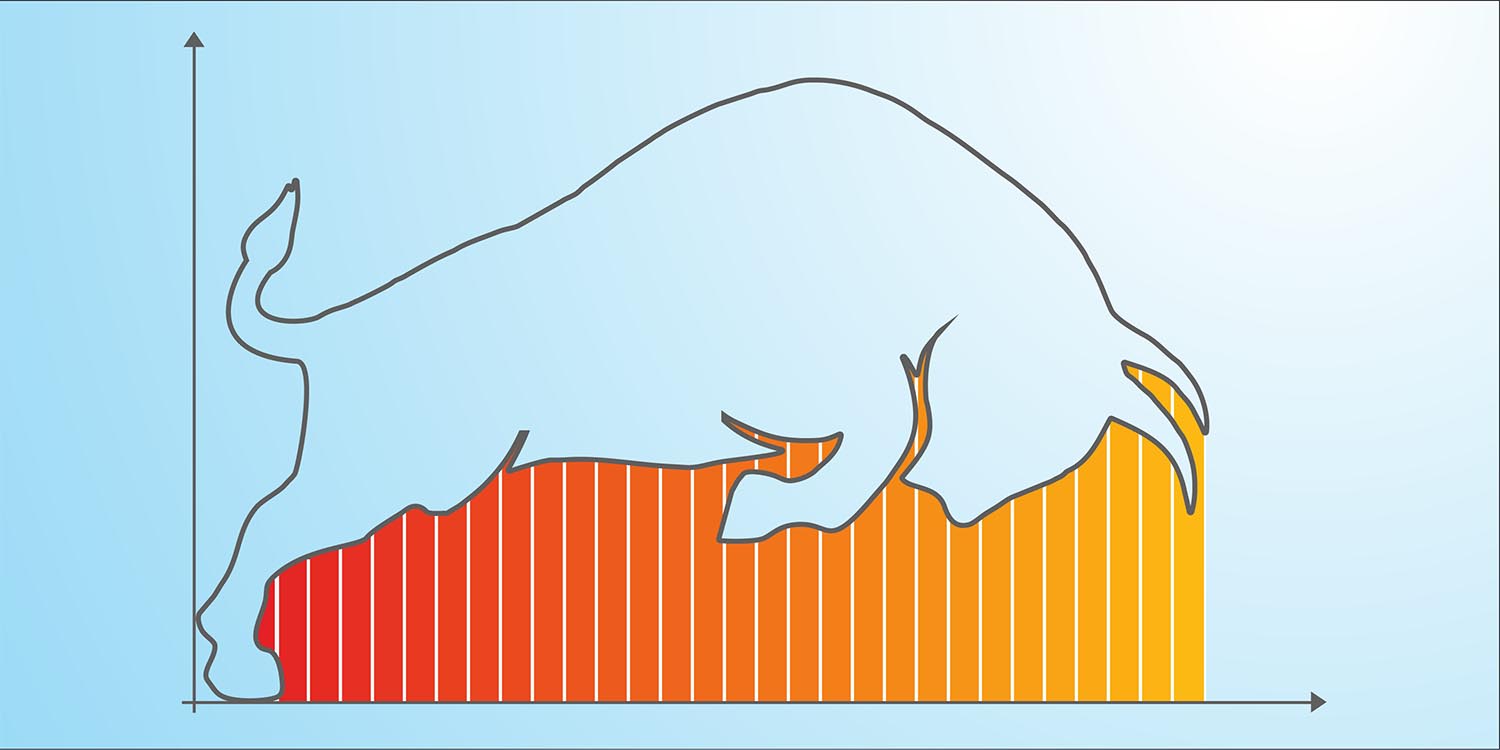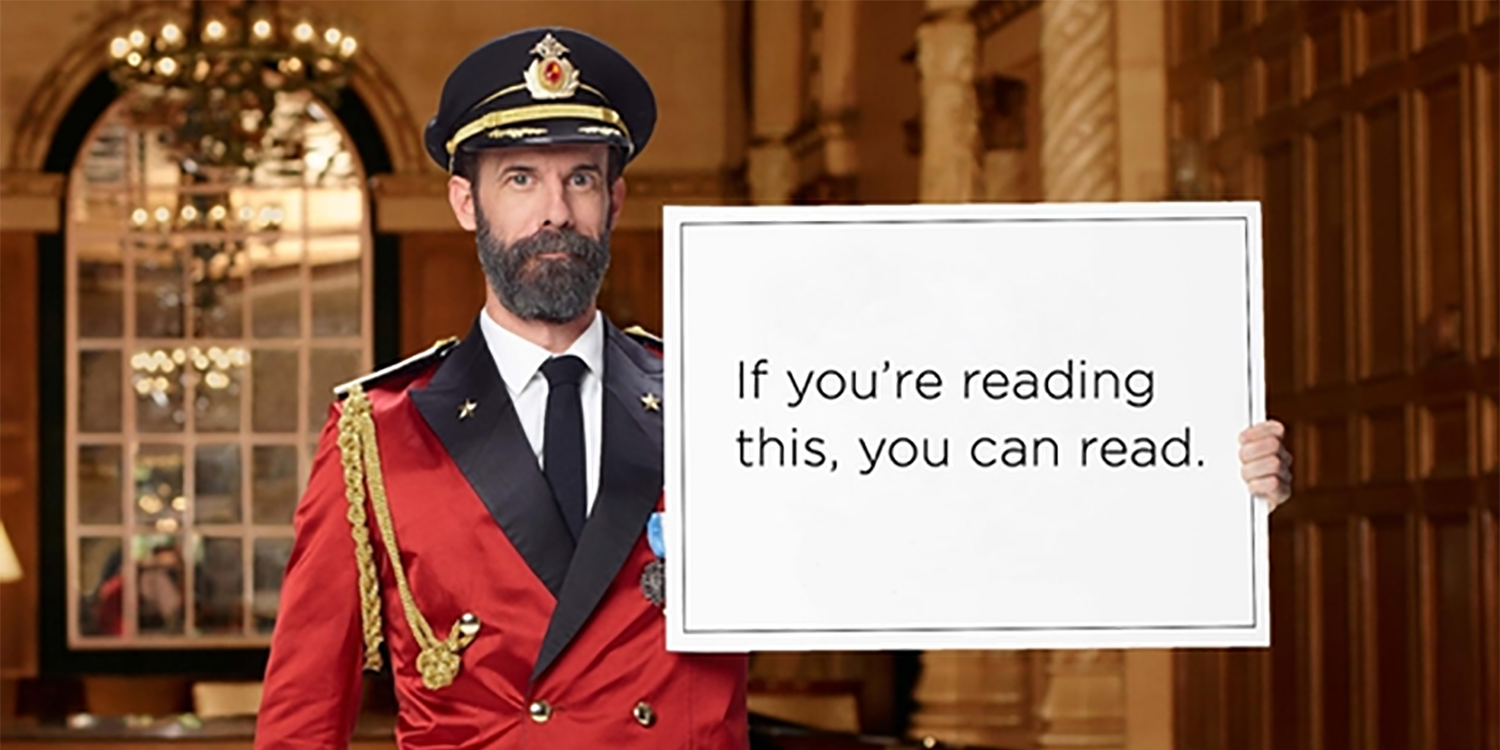Kleinigkeiten der supply chain Terminologie
Das Entstehen einer Terminologie ist bestenfalls ein zufälliger Prozess. Supply chain ist keine Ausnahme und rückblickend ist ein beträchtlicher Teil der supply chain Terminologie unzureichend. Verwirrende Terminologie schadet sowohl Neulingen als auch erfahrenen Praktikern. Neulinge kämpfen mehr als nötig mit unbeabsichtigter Komplexität. Praktiker erkennen möglicherweise nicht, dass das Fundament ihres Fachgebiets brüchiger ist, als es den Anschein hat.

Betrachten wir die größten Übeltäter in Sachen Terminologie im supply chain und schlagen passende Alternativen vor. Selbst wenn diese Alternativen wahrscheinlich nie von der Community übernommen werden, sollten sie einige der übersehenen Nuancen beleuchten. Als Faustregel gilt: Gute Terminologie sollte so neutral und sachlich wie möglich sein. Das Einfügen von positiven oder „coolen“ Qualifikatoren ist ein Warnsignal.
Die ABC analysis hätte moving average segmentation heißen müssen. Terminologisch bringt der Begriff „ABC“ nichts, während „analysis“ so vage wie möglich ist. Der Ausdruck „moving average segmentation“ ist spezifischer. Er verdeutlicht die inhärenten Mängel dieser Methode. Tatsächlich schaffen moving averages nicht nur Instabilität im Zeitverlauf, sondern erfassen auch keine Schlüsselmuster, wie etwa cyclicities. Außerdem ist segmentation ein crude Mechanismus, der per Design auf der SKU Ebene keine granulare Reaktion liefern kann.
APS (Advanced planning and scheduling) hätte planning management heißen müssen. Zunächst gibt es nichts „advanced“ an diesen Softwareprodukten. Dieser Begriff wurde in den 1990er Jahren von Marktanalysten geprägt, um eine Reihe von software vendors aufzupolieren. Die meisten Softwareprodukte, die unter den APS-Schirm fallen, können nach den Maßstäben der 2020er Jahre nicht mehr als „advanced“ betrachtet werden. Zweitens betont planning management Prozesse, die durch umfangreiche manuelle Dateneingaben gekennzeichnet sind. Statistische Funktionen machen nur einen winzigen Bruchteil der Software aus. Der Großteil der Softwarefunktionen ist dem Endbenutzer gewidmet, d.h. dem supply and demand planner, der den Plan manuell verwaltet.
BI (Business Intelligence) hätte cube reporting heißen müssen. Erstens hat diese Technologie nichts mit Intelligenz im Sinne von „artificial intelligence“ oder mit Intelligenz im Sinne von „secret intelligence service“ zu tun. Daher gehört der Begriff „intelligence“ hier nicht hin. Zweitens gibt es nichts inhärent „business“-Spezifisches an dieser Technologie. Zum Beispiel ist die Darstellung vergangener täglicher Temperaturen pro Postleitzahl ein guter Anwendungsfall für einen Cube Report. Cube reporting ist eine Benutzeroberfläche, die über einem Cube-Datenspeicher liegt, welcher in der Datenbankterminologie auch als OLAP (online analytical processing) bekannt ist. Der Cube bietet Slice-and-Dice-Operationen. Auch wenn der Begriff „cube“ verwendet wird, muss die Anzahl der Dimensionen nicht gleich 3 sein. Dennoch bleibt es in der Praxis eine einstellige Zahl aufgrund der kombinatorischen Explosion, die mit höheren Dimensionen einhergeht.
ERP (Enterprise Resource Planning) hätte ERM heißen müssen, was für Enterprise Resource Management steht. Ihr Hauptziel ist, wie der ERM-Name andeutet, die Verfolgung der Vermögenswerte des Unternehmens. Diese Produkte haben wenig oder gar nichts mit Planung zu tun. Das Kerndesign von ERM, das stark auf einer relationalen Datenbank beruht, steht im Widerspruch zu jeglichen prädiktiven Fähigkeiten. Die „ERP“-Terminologie wurde in den 1990er Jahren von Marktanalysten vorangetrieben, um eine Reihe von Softwareanbietern zu fördern, die versuchten, sich von ihren Konkurrenten zu differenzieren. Allerdings gab es nie viel Substanz hinter dem „planning“-Anspruch. Softwaretechnisch ist der transaktionale Bereich heute deutlich stärker vom prädiktiven Bereich getrennt als je zuvor.
MRP (Material Requirements Planning) hätte MRM (Manufacturing Requirement Management) heißen müssen. Die Gründe sind im Wesentlichen denen aus der Diskussion ERP vs. ERM ähnlich. Es ist wenig oder gar keine Planung darin enthalten und, falls doch, tendiert das Design stark zu einem manual process. Außerdem ist der Begriff requirements veraltet, da er in erster Linie auf die Verwaltung der BOM (Stückliste) verweist, was heutzutage nur einen kleinen Teil dessen ausmacht, was das moderne Fertigungsmanagement beinhaltet. Somit gibt es wenig Grund, diesen Begriff besonders zu betonen.
Eaches (EA), eine Maßeinheit, sollte besser obvious units (OU) genannt werden. Eaches werden verwendet, wenn die relevante Maßeinheit, während der Bestandsverfolgung, als selbsterklärend angesehen wird, wie es bei verpackten Waren normalerweise der Fall ist. Leider geht der ursprüngliche Sinn im Begriff „eaches“ verloren. Außerdem ist „eaches“ grammatikalisch merkwürdig. Die Einzahl ist verwirrend, z.B. „1 each“, und wird daher in der Praxis vermieden.
EDI (Electronic Data Interchange) stammt aus den 1970er Jahren und bezieht sich überwiegend auf Software, die Bestellungen an Lieferanten übermittelt und dadurch bürokratische Eingriffe im Bestellprozess eliminiert. Leider qualifiziert sich beim Aufkommen des Internets selbst das Surfen im Web technisch gesehen als ein EDI-Prozess. Der Begriff integrated suppliers (umgekehrt integrated clients), der auf eine Integration der jeweiligen IT-Systeme hinweist, wäre eine bessere Art, die Situation zu umschreiben.
EOQ hätte flat bulk order heißen müssen. Tatsächlich liegt hinter diesem Begriff, der einen allgemeinen Zweck zu erfassen scheint, eine vereinfachte Formel, die annimmt, dass die future demand konstant ist (keine Saisonalität), dass die lead time konstant ist (keine Variabilität), dass die Bestellkosten konstant sind (kein Preisvorteil) und schließlich, dass die carrying cost konstant ist (kein Verfallsdatum). Der Ausdruck flat bulk order vermittelt präzise den tatsächlich vereinfachten Charakter der Formel.
Order ist ein gutes Wort, aber für sich allein ist es auch zutiefst mehrdeutig. Es gibt Kundenorders, Lieferantenorders, Produktionsorders, inventory movement Orders, Ausschussorders usw. Ein qualifizierendes Präfix ist nötig, um den Ausdruck verständlich zu machen. Der Begriff „level“ ist in dieser Hinsicht ähnlich und darf nicht ohne ein qualifizierendes Präfix verwendet werden.
Safety stock hätte Gaussian buffer heißen müssen. Tatsächlich gibt es nothing safe an dieser Methode nicht. Sie beruht darauf, dass sowohl die future demand als auch die future lead time normalverteilt sind (Gaussians), was niemals der Fall ist, da die interessierenden Verteilungen im Bereich supply chain nicht normalverteilt sind. Der Begriff buffer verdeutlicht die Intention, die mit dem Bestand verbunden ist, ohne eine spezifische Eigenschaft für diese Anordnung zu implizieren.
Seasonality ist ein guter Begriff, aber in der Regel wäre der Begriff cyclicities aus supply chain Sicht passender. Tatsächlich macht es wenig Sinn, die Analyse des Nachfrageverhaltens auf die jährliche Zyklizität, d.h. die seasonality, zu beschränken. Wochentag und Monatstag sind weitere offensichtliche cyclicities, die zwangsläufig berücksichtigt werden müssen. Somit sucht ein supply chain director selten eine seasonality Analyse, sondern eher eine cyclicity Analyse.
Service level hätte service rate heißen müssen, was konsistenter mit fill rate wäre. Der Begriff level deutet auf eine Menge hin, wie etwa stock level. Allerdings ist der service level ein Prozentsatz. Es ist wahrscheinlich einer der weniger gravierenden Fehler in dieser Liste. Dennoch wäre es schöner, wenn man die Dualität service rate vs. fill rate direkter vermitteln könnte.
Sogar (relative) supply chain Neulinge würden von einer besseren Terminologie profitieren.
DDMRP (demand driven material requirements planning) hätte sparse prioritized buffering heißen müssen. Tatsächlich liefert diese Methodik nichts Spezifisches, um die „wahre“ Nachfrage vom Fluss zu isolieren: Zensur, Kannibalisierungen oder Substitutionen existieren in diesem Rahmen überhaupt nicht numerisch. Ebenso fehlen die meisten Planungsperspektiven im numerischen Rahmen: range planning, phase-in, phase-out, promotions, etc. Das Schlüsselwort „sparse“ beschreibt treffend die Intention, die mit der Einführung von „decoupling points“ verbunden ist.
Decoupling points hätten managed SKUs heißen müssen. DDMRP schlägt ein Graphfärbeschema vor, das die SKUs in zwei Gruppen aufteilt: die decoupling points und den Rest. Es ist klarer, diese „points“ als SKUs zu bezeichnen. Außerdem, da diese SKUs die einzigen sind, die tatsächlich vom demand and supply planner inspiziert werden sollen, passt der Ausdruck „managed SKUs“ gut und verdeutlicht, dass alle anderen SKUs aus der Sicht des Planers „unmanaged“ sind.
In gewissen Situationen können dramatische Vereinfachungen erreicht werden.
Artificial intelligence, autonomous system, blockchain, cognitive system, demand sensing, demand shaping, digital brain, knowledge graph, optimal algorithms können im Wesentlichen alle durch das Wort magic ersetzt werden. Während es außerhalb der supply chain Kreise bei einigen dieser Schlagwörter unterschiedliche Grade echten Engineerings gibt, handelt es sich im Kontext von supply chain Unternehmenssoftware um reine Vaporware.
Schließlich bleiben einige Begriffe angemessen, auch wenn sie gelegentlich Kritik ernten.
Value Chain wird manchmal als Ersatz für Supply Chain vorgeschlagen. Ein solcher Ersatz spiegelt ein mangelndes Verständnis von Say’s Gesetz wider, benannt nach der Arbeit von Jean Baptiste Say, einem Ökonomen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Dieses Gesetz lässt sich zusammenfassen als supply is the source of demand. Zuerst kommt die supply, dann die demand und zuletzt der value, wenn Transaktionen endgültig stattfinden. Die chain verbindet das gesamte Geschehen. Die Value Chain wird vor allem von Beratern angepriesen, die versuchen, ihren potenziellen Kunden eine ROI zu verkaufen. Allerdings ist der Begriff „value“ weniger spezifisch und positiver gefärbt als sein Pendant „supply“.