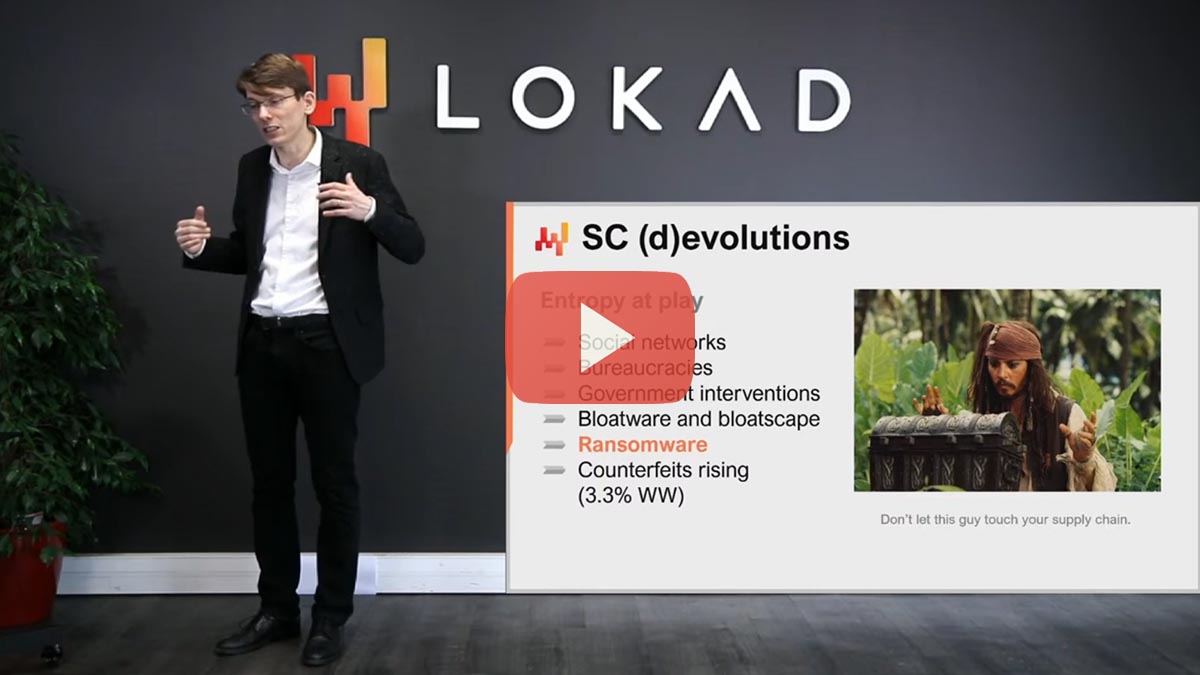Trends des 21. Jahrhunderts in Supply Chain (Vorlesung 1.5 Zusammenfassung)
Während das 20. Jahrhundert sich mit der Produktionsautomatisierung auseinandersetzte - und diese effektiv bezwang - hadert das 21. Jahrhundert mit völlig anderen Arten von Komplexität. Im Gegensatz zum vorigen Jahrhundert, dessen Entropie1 weitgehend auf physische Einschränkungen beschränkt war, befinden sich moderne supply chain in einem viel größeren Wandel. Dieser Wandel umfasst die gleichen physischen Herausforderungen der vergangenen 100 Jahre (z. B. das Reagieren auf Naturkatastrophen), wird jedoch zusätzlich durch stochastische Trends und Verbraucherforderungen, die durch die gestiegene Globalisierung und technologische Fortschritte entstehen, verstärkt. Die genaue Bestimmung des Umfangs der bevorstehenden Herausforderung ist der erste Schritt in einer effektiven supply chain-Optimierung.
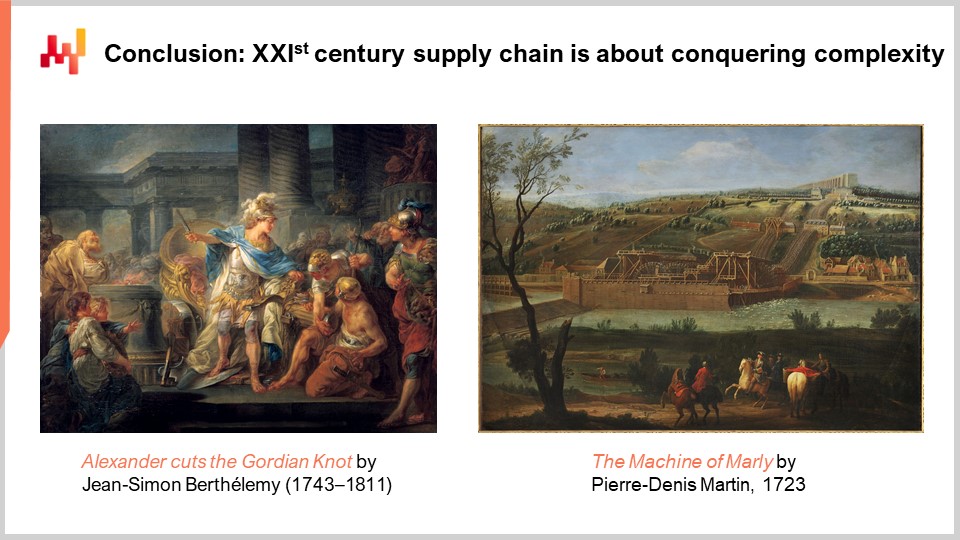
Vorlesung ansehen
Bessere Benutzererfahrung (UX)
Das Verbraucherverhalten und die Erwartungen entwickeln sich tendenziell mit den Fortschritten der verfügbaren Technologie. Ein gutes Beispiel sind die immer ausgefeilteren Telekommunikationssysteme der 1970er Jahre, die wiederum die Entstehung von Callcentern ermöglichten und in der Folge die Ära des Telesales einläuteten. Aus der Perspektive der supply chain war dies außergewöhnlich und stellte eine Art Beta-Version der Komplexität dar, die wir heute beobachten2.
Lieferung am selben Tag
50 Jahre später hat der E-Commerce diese Komplexität aufgenommen und um unzählige Aufträge erhöht. Obwohl Produkte oft noch per Hand geliefert werden, ist die Methode, mit der Bestellungen aufgegeben, verarbeitet und verfolgt werden, exponentiell komplizierter. Lieferung am selben Tag, um nur ein Beispiel zu nennen, erhöht die gesamte Komplexität bei der Erfüllung von Kundenaufträgen, indem sie die Überlegungen der supply chain verstärkt.
Auf der vorgelagerten Seite müssen diesem Unterfangen ausreichende Ressourcen zugewiesen werden, namentlich Zustellpersonal, Fahrzeuge und Ausrüstung. Auf der nachgelagerten Seite bedeutet der verkürzte Zeithorizont für die Lieferung eine beschleunigte Bearbeitung, Kommissionierung, Verpackung und den Versand von Bestellungen, was sowohl eine Optimierung der Routenplanung als auch die Schulung und/oder Ausstattung des Personals mit entsprechender GPS-Technologie erfordert. Ganz zu schweigen von der zusätzlichen Prognose-Entropie, die durch Lieferung am selben Tag eingeführt wird.
Konfigurierbarkeit
Im vorigen Jahrhundert konzentrierten sich industrielle Muster vorwiegend auf Massenproduktion, und diese begrenzte Vielfalt machte die Optimierung von Produktions- und supply chain-Prozessen zu einer weitaus weniger komplizierten (wenn auch sicherlich nicht einfachen) Aufgabe. Heutzutage ermöglichen moderne Konfigurierbarkeits-Optionen den Verbrauchern, ihre Käufe in einem Maße präzise abzustimmen, das vor einem Jahrhundert praktisch undenkbar war.
Obwohl dies für Kunden sicherlich ein Segen ist, erhöht es die gesamte supply chain-Entropie in mehrfacher Hinsicht. Über die erhöhte Schwierigkeit der Nachfrageschätzung für die einzelnen SKUs in einem Konfigurator3 hinaus werden Qualitätskontrolle und Auftragsabwicklung exponentiell komplizierter, je mehr Konsumentenoptionen hinzukommen.
Programmatische Optionen
Eine weitere Klasse der supply chain-Komplexität ist die Reihe programmatischer Optionen, die man nutzen kann, um die oben beschriebene Entropie zu bewältigen. Obwohl diese darauf ausgelegt sind, den supply chain-Praktiker zu unterstützen, bringt jede Option ihre eigenen Überlegungen mit sich. Einige Beispiele sind:
Cloud 3PLs: Cloud-basierte Third-Party-Logistics und Lagerung, wie beispielsweise Amazons FBA (Fulfillment by Amazon), können Unternehmen erhöhte Flexibilität und reduzierte Infrastrukturkosten bieten.
Diese Dienste sind jedoch in erster Linie darauf ausgelegt, über APIs betrieben zu werden, die auf den bereits bestehenden Enterprise-Systemen des Kunden aufsetzen, was zu Integrations-, Kompatibilitäts- und Akzeptanzproblemen führen kann4.
Autonome Fahrzeuge: Obwohl dies noch eine relativ junge Technologie ist, ist die langfristige Rentabilität autonomer Fahrzeuge in der supply chain offensichtlich. Automatisierte, geführte Fahrzeuge (AGVs) und autonome mobile Roboter (AMRs) reduzieren nicht nur menschliche Fehler im Transport, sondern können auch eingesetzt werden, um bestimmte Lagerhausfunktionen, wie Kommissionierung und Verpackung, zu automatisieren.
Ähnlich wie bei 3PLs gilt es auch hier, eine Reihe von infrastrukturellen Hürden und Akzeptanzbarrieren zu überwinden, wenngleich die Zukunft in diesem Bereich sehr vielversprechend ist5.
Vorausschauende Wartung: Da Elektronik zunehmend erschwinglicher geworden ist, kann moderne Maschinerie mit tausenden von Sensoren ausgestattet werden, deren Zweck es ist, Daten zur Leistung und Integrität der Maschine selbst zu sammeln. Diese Daten können - wieder einmal mithilfe von Automatisierung - analysiert werden, um Probleme proaktiv zu identifizieren bevor ein unerwünschtes Ereignis eintritt.
Der Luftfahrtsektor ist ein bemerkenswertes Beispiel, in dem es üblich ist, Sensoren in Flugzeugen zu installieren. Diese Sensoren erfassen Daten über tausende Flugstunden, die mithilfe von Machine-Learning-Algorithmen analysiert werden, um Anzeichen für einen möglichen Ausfall zu erkennen. Ein Airbus A350 verfügt über bis zu 50.000 solcher Sensoren, und die gesammelten Daten reduzieren nicht nur Kosten und Ausfallzeiten, sondern retten potenziell Leben6.
Supply Chain (d)Evolutionen
Ein bedauerlicher Vektor des Chaos ist die gelegentliche Neigung der Welt zu einem Chaos um der selbst willen. Anders als bei der zuvor beschriebenen Entropie, bei der eine erhöhte supply chain-Unordnung ein unglückliches Ergebnis positiver Evolution war, stellt diese Art von Entropie den Tiefpunkt menschlicher Erfindung dar, das heißt, supply chain-Komplexität durch Devolution.
Einfach ausgedrückt handelt es sich hierbei um Fälle, in denen die supply chain-Komplexität ohne greifbaren Nutzen zunimmt und in der Regel durch fehlerhafte Eingriffe entsteht. Zu diesen Vorboten des Chaos gehören unter anderem:
Soziale Netzwerke: Trotz der zahlreichen Marketingchancen können Online-Netzwerkplattformen zusätzliche und unbeabsichtigte Volatilität einführen, wie beispielsweise Produkte, die über Nacht zu Trends werden und weltweit eine hohe Nachfrage erleben7.
Umgekehrt kann der Ruf eines Kunden (oder der Ruf eines wichtigen Lieferanten/Abnehmers) in nur wenigen Minuten durch einen Sturm in den sozialen Medien völlig zerstört werden. Jedes dieser digitalen Ereignisse (um nur einige zu nennen) kann in der supply chain verheerende Auswirkungen haben.
Staatliche Regulierung: In der Mitte des 20. Jahrhunderts unterlagen US-Unternehmen etwa 2.600 Seiten an Vorschriften; heutzutage ist diese Zahl auf über 200.000 angestiegen8. Angesichts der geografisch verteilten und miteinander verflochtenen Natur der supply chain hat bundesstaatliches Handeln in einer Gerichtsbarkeit tendenziell Auswirkungen auf das gesamte System.
Diese Eingriffe können so unvorhergesehen wie auch rasch und verheerend sein. Zum Beispiel kann die Schließung einer Fabrik in Shenzhen aufgrund eines lokalen Lockdowns dazu führen, dass supply chains in Sevilla in völliges Chaos geraten.
Bloatware: Software ist ein Segen für die Logistik und bildet die eigentliche DNA der die Quantitative Supply Chain, aber das bedeutet nicht, dass alle aufsteigenden Schiffe seetüchtig sind. Anbieter neigen dazu, ihren Produkten ständig Funktionen und Fähigkeiten hinzuzufügen, um neue Versionen und Upgrades zu verkaufen.
Dies führt dazu, dass Software zunehmend komplexer wird, manchmal bis zu dem Punkt, an dem sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht9.
Die Komplexität bezwingen
Philosophisch betrachtet kann die Komplexität, der man in der supply chain begegnet, durch zwei verschiedene Perspektiven gesehen werden: jene, die zufällig ist, und jene, die absichtlich herbeigeführt wird. Letztere ist oft menschengemacht und kann reduziert werden, wenn man den Mut hat, unnötige Bürokratie und Ineffizienzen zu durchbrechen; die erstere hingegen ist in der Regel ein inhärentes Merkmal eines Systems und erfordert typischerweise überlegene Technologie.
Zufällige Komplexität umfasst die langsame und stetige Ansammlung redundanter Kommunikationskanäle im Tagesgeschäft, wie beispielsweise langatmige, Tugendsignalisierende E-Mails und Meetings. Diese erscheinen vielleicht trivial, aber die Opportunitätskosten verschwendeter Ressourcen und Bandbreite summieren sich allmählich10.
Diese Art von Komplexität ist ein Fehler und kein Feature, weshalb sie weitgehend allein durch umsichtiges Management beseitigt werden kann.
Absichtliche Komplexität, in supply chain-Begriffen, umfasst alle Faktoren, die von Natur aus kompliziert sind. Die eigentlichen Grundlagen der supply chain, zum Beispiel, bestehen darin, die Optionalität, Variabilität und den Fluss physischer Güter über das weite und verteilte Netzwerk der supply chain zu meistern.
Diese Komplexitäten bestehen, unabhängig davon, wie übersichtlich der Google-Kalender eines Menschen ist. Sie sind definitionsgemäß in ihrer Komplexität komplex und, im Gegensatz zu Fällen unabsichtlicher Komplexität, Hürden, die nicht allein durch Willenskraft überwunden werden können. Sie müssen mit geeigneter und überlegener Technologie angegangen werden.
Anmerkungen
-
Entropie ist ein Maß für den Grad der Unordnung oder Zufälligkeit in einem System. Hohe Entropie zeigt an, dass ein System unordentlich ist; niedrige Entropie weist auf ein geordnetes System hin. Stell dir ein Kartenspiel vor, das ordentlich aufsteigend nach Wert gestapelt ist, wobei die Farben in alphabetischer Reihenfolge angeordnet sind. Man könnte sagen, dass dieses Kartenspiel eine relativ niedrige Entropiebewertung hat (ausgedrückt in Joule pro Kelvin, falls dies ein reales Beispiel wäre). Derselbe Stapel, nun gemischt, hätte aufgrund der gesteigerten Zufälligkeit eine deutlich höhere Entropiebewertung. Würde man das Kartenspiel in einen heftigen Windstoß werfen, würde die Entropie, wie man sich vorstellen kann, noch weiter ansteigen. ↩︎
-
Telesales führte zu groß angelegten Fernbestellungen, was das supply chain-Management durch den erhöhten Bedarf an noch präziseren Nachfrageprognosen, effizienter Bestandsverwaltung und termingerechter Auftragsabwicklung verkomplizierte. Der Wechsel von persönlichen Verkäufen zu telefonbasierten Transaktionen erforderte zudem eine robuste Logistikinfrastruktur und zuverlässige Lieferdienste, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten. ↩︎
-
Auch bekannt als Choice Boards oder Designsysteme, unterstützen diese Online-Mechanismen Verbraucher im Konfigurationsprozess, beispielsweise bei der Anpassung einer Computerbestellung. ↩︎
-
Eine API – Application Programming Interface – ist ein Satz von Regeln und Protokollen, der es Softwarekomponenten ermöglicht, miteinander zu interagieren. Sie ist die Brücke zwischen der unternehmenseigenen Software, wie beispielsweise einem ERP, und der eigenen Schnittstelle des 3PL (der API), die den Austausch von Daten und Informationen erleichtert. ↩︎
-
Sicherheits- und Schutzfragen, staatliche Regulierung und gesellschaftliche Akzeptanz sind drei unmittelbare Herausforderungen für eine weit verbreitete Einführung. ↩︎
-
Die Integration, Datenverwaltung und die insgesamt steilere Lernkurve für vorausschauende Wartung sind ausgeprägter als in den beiden vorherigen Beispielen in diesem Abschnitt. Dennoch ist, je nach Branche, der potenzielle langfristige Nutzen kaum zu überschätzen. ↩︎
-
Viral gehen, im Jargon unserer Zeit. ↩︎
-
Abbildung entnommen dem Abschnitt ‘Regulations’ von plainlanguage.gov. Beachte, dass diese Daten weder staatliche noch lokale Vorschriften oder die Richtlinien zusätzlicher Regulierungsbehörden beinhalten. Dies ist rein der allgemeine, bleibende und übergreifende Rahmen, der von der Bundesregierung festgelegt wurde. Dies wird nicht als inhärent negativ dargestellt, sondern vielmehr als Indikator dafür, dass der Trend eindeutig in Richtung verstärkter Aufsicht tendiert (zum Guten wie zum Schlechten). ↩︎
-
Da supply chains auf mehreren miteinander verbundenen Softwareanwendungen (APIs, ERPs usw.) beruhen, kann dies wiederum ein schlaffes Bloatscape erzeugen. ↩︎
-
Verschwendete Zeit tritt in vielen Formen auf, aber das Endergebnis bleibt dasselbe. Eine mathematische Denkweise ist hier hilfreich. Ein einziges sinnloses Meeting pro Tag (das beispielsweise 20 Minuten dauert) summiert sich auf fast 80 verschwendete Arbeitsstunden pro Jahr oder zwei volle Arbeitswochen (bei einem typischen US-Arbeitsjahr mit großzügigen 4 Wochen Urlaub). ↩︎